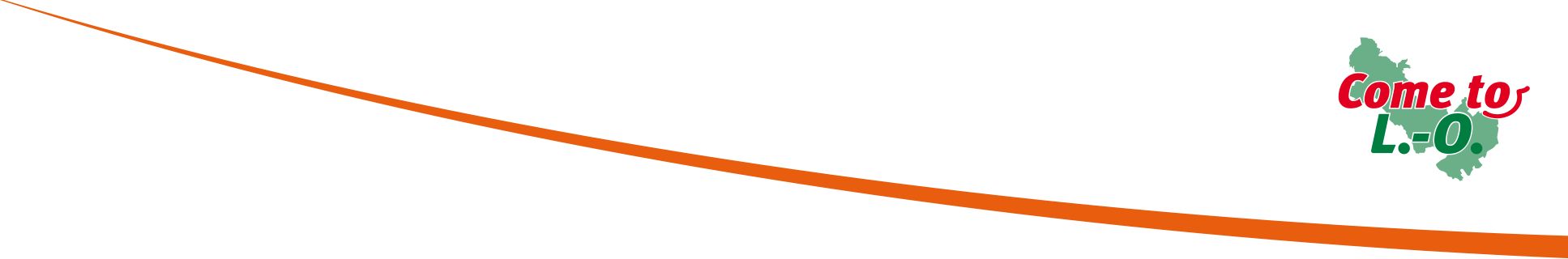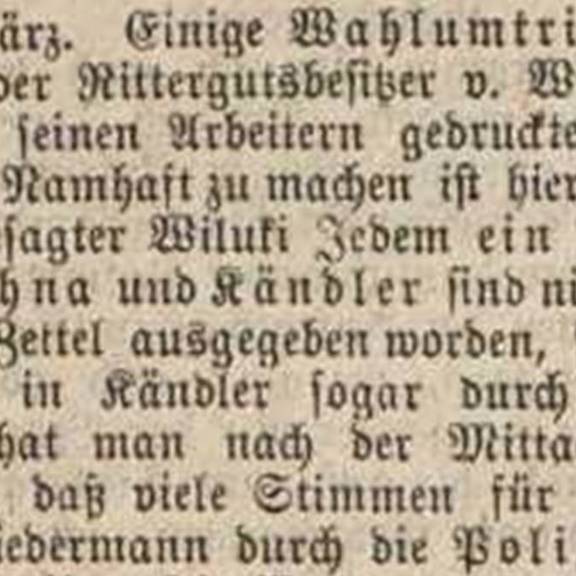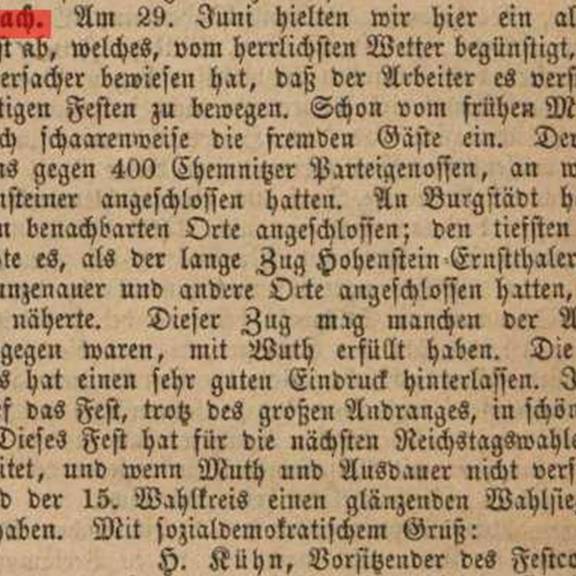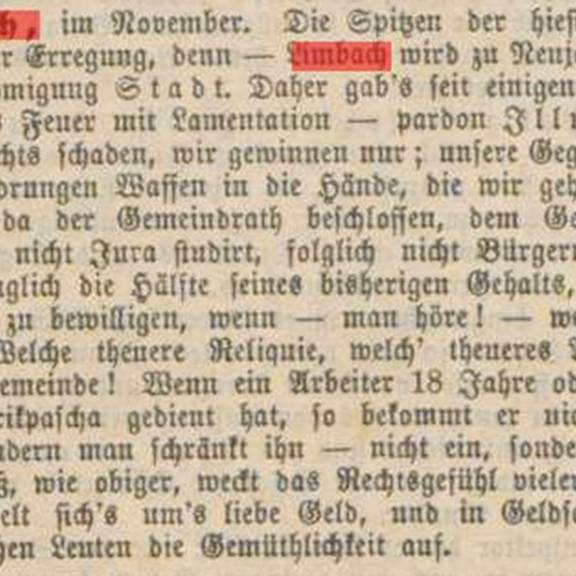Das Schützenhaus
Das Schützenhaus
Die Privilegierte Schützengesellschaft Limbach wurde am Himmelfahrtstag 1835 gegründet. Sie richtete sich einen Schießstand mit einer hohen Stange für das „Vogelschießen" in der sog. Töpferlehde ein. Schon 1842 reichte die Anlage für die Bedürfnisse der Schützen nicht mehr aus und sie kauften eine an das Grundstück des Försterhäuschens angrenzende Fläche auf Oberfrohnaer Flur von rund 1,6 Hektar für 700 Taler.
Nach Vorgangerbauten eines Schießhauses mit Schankstube und Kegelschub wurde im Frühjahr 1870 mit dem Bau eines größeren, massiven Gebäudes mit Restaurant und Tanzsaal begonnen, zugleich auch mit dem Bau der Straße vor dem Haus. Der Baumeister Meinig aus Limbach wurde mit dem Bau des Schützenhauses beauftragt, Gottlieb Wolf mit dem Ausbau der Straße. Der alte Kegelschub wurde abgerissen und dafür eine neue, überdachte Kegelbahn entlang der Straßenseite gebaut und in deren Fortsetzung eine neue Schießhalle errichtet.
Vom 25. bis zum 31. Juli 1871 sollte das Schützenhaus eingeweiht werden, da aber gerade zu diesem Zeitpunkt der Deutsch-Französische Krieg (19.7.1870-10.5.1871) ausbrach, wurde die Einweihung verschoben und fand erst am 11.Juni 1871 statt. 1876 kaufte der Gastwirt Theodor Gentzsch das Schützenhaus, später u.a. Linus Schubert. 1882 wurde das Gebäude erweitert, ein weiterer Umbau 1900 war von einem Unglück begleitet durch Verschulden des Bauunternehmers stürzte nachts der Tanzsaal vollständig in sich zusammen. Glück im Unglück. Am nächsten Tag war ein Öffentliches Konzert in dem Saal angesetzt gewesen. Der Saal wurde dann noch größer wiederaufgebaut. Am 18. Dezember 1883 ersuchte der Baumeister Richard Ludewig den Limbacher Stadtrat, eine Straße bis zum Schützenhaus bauen zu wollen, der Anfang der Schützenstraße. 1887 meldet der Baumeister die Fertigstellung der Straße, die 1888 von der Stadt übernommen wird.
Als hinderlich wurde von Anfang an gesehen, dass der Schützenplatz sich auf Oberfrohnaer Flur befand, zum Beispiel kassierte Oberfrohna die Schank- und Vergnügungssteuer auf diesem Grundstock. Limbacher Bemühungen zur Eingemeindung blieben aber erfolglos. Das änderte sich erst 1931, als das Schützenhaus zur Versteigerung kam. Es ging unter der Bezeichnung „Volkshaus" in das Eigentum der KPD über. Das führte zu Reibereien und Zusammenstößen mit den Schützen, die sich nach einem anderen Grundstück für ihre Gesellschaft umsahen. 1931 wurden die Vorstandmitglieder (Hertling, Zschernitz, Götz) fündig. Sie fanden den ehemaligen Fußballplatz des Limbacher Klubs „Helias", der an die Gaststatte „Kreuzeiche" anschließt, geeignet. Ein Streifen der daneben liegenden städtischen Obstplantage sollte zur Schießanlage umgebaut werden. Mit dem 1. April 1931 wurde der Mittelfrohnaer Ortsteil Kreuzeiche nach Limbach eingemeindet. Damit zählte die Stadt Limbach nun 18.605 Einwohner. Jetzt kam auch der Grundstücksaustausch mit Oberfrohna in Gang, mit Vertrag vom 5.11.1931 übernahm Limbach den bisherigen Schützenplatz, die Schützengesellschaft bekam den großen Sportplatz an der Kreuzeiche. Schon 1932 wurden Schützenplatz und Schießhalle mit einem Schützenfest eingeweiht. Im Juni 1932 nahm der Gasthof „Kreuzeiche" den Namen „Schützenhaus Limbach" an.
Das „Volkshaus“ an der Schützenstraße wurde 1938 wegen Baufälligkeit abgerissen. An seiner Stelle baute Georg Gunther seine Molkerei (Pestalozzistraße 29), die 1940 bis 1972 in Betrieb war, danach noch bis 1992 als Betriebsteil des VEB Molkerei Siegmar. Das Gebäude steht noch.
Quellen: Paul Fritzsching, Limbach Heimatstudien 1933
Wilhelm Schilling, Chronik der Stadt Limbach 1899
Richard Wunschmann, Die Privilegierte
Schützengesellschaft Limbach
Michael Nestripke
Vorsitzender Förderverein Esche Museum e.V.
Zum Gedenken an Mundartdichter Herbert Köhler
Zum Gedenken an Mundartdichter Herbert Köhler
Vor mehr als 40 Jahren verstarb am 30. November 1982 nach langer schwerer Krankheit der Schriftsteller Herbert Köhler, für den „Langeweile“ ein Fremdwort war, denn seine eigene Aussage „Mein Leben hat mich manches erfahren und empfinden lassen, nur eines nicht: Langeweile“, bekräftigte diese Feststellung. Anlässlich seines 40. Todestages möchten wir den Erinnerungen an den Heimatdichter diese Worte voranstellen. Die Vorfahren väterlicherseits waren einst aus Schottland eingewandert. Herbert Köhler erblickte am 9. Juli 1906 das Licht der Welt in Oberfrohna, wo er auch die Volksschule besuchte. Im Jahre 1921 begann Köhler eine Lehre in einer Handschuhfabrik, die hauptsächlich ihre Waren exportierte, um danach einmal als Fremdsprachenkorrespondent tätig zu sein. Dennoch hat er sich seine Heimatsprache stets bewahrt und wurde somit zu einem der besten, eigenwilligsten und eigenständigsten Autoren erzgebirgischer Mundartdichtung im vorerzgebirgischen Raum. Köhler hat mit seinen mundartlichen Erzählungen und Gedichten sich selbst und seine Heimat dargestellt. Darüber hinaus bereicherte Herbert Köhler auch in hochdeutsch geschriebenen Werken (Gedichte und Aufsätze) die Volkskunde unserer unmittelbaren Heimatregion und so war er unter anderem aktiv an der Erarbeitung des „Wörterbuch der obersächsischen Mundarten“ bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig beteiligt gewesen. Übrigens entstand seine erste Mundartgeschichte in Belgien während des Zweiten Weltkrieges und 1951 folgte eine zweite, dem über 60 weitere Geschichten folgten. Nach Kriegsende war er als Exportkaufmann tätig. Die eigentliche Mundartschreiberei begann er erst 1955. Sicher erinnern sich noch manche Leser an seine Geschichten in heimatkundlichen Publikationsorganen, wie dem „Heimatfreund für das Erzgebirge“ oder im Kalender „Sächsische Gebirgsheimat“, wo er über 20 Jahre mit Erzählungen und so weiter erschienen ist. Zu seinen besonderen Geschenken an gute Freunde gehörten aber auch sehenswerte kunstschriftliche Arbeiten, denn neben seiner Autorentätigkeit fand er viel Spaß und Zeit beim Umgang mit der Schrift und Schriftgestaltung und gelegentlich war er auch als Lektor für englische und schwedische Literatur tätig. Nebenberuflich wurde er ab 1956 als Mitarbeiter des Wörterbuches der obersächsischen Mundartforschung bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig aktiv. Durch seine Tätigkeit half er mit, das alte Wortgut der vorerzgebirgischen Mundart festzuhalten, die mehr als andere erzgebirgische Mundarten dem allmählichen Verfall ausgesetzt war und heute kaum noch gesprochen wird. Dadurch erwarb er sich bleibende Verdienste.

Text und Foto: Friedemann Bähr, Stollberg
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 16. Februar 2023 -
Der ehemalige Kaiserhof in Kändler – ein Rückblick
Der ehemalige Kaiserhof in Kändler – ein Rückblick
In der Chronik von Horst Strohbach wurden noch 1940 sieben Gaststäten, Schankgenehmigungen der beiden Sportvereine, Kaffeeausschank in der Bäckerei Junghans und Konditorei Hunger, sowie zwei Bierhandlungen genannt.
Der größte Gasthof war der „Kaiserhof“ an der Hauptstraße 35. Er geht auf eine Schänke des Rittergutes zurück. Ab 1609 werden die Gastwirte bzw. Besitzer der Schänke aufgeführt. Als letzter Besitzer seit 30.5.1920 wird Ernst Rudolph Teichmann genannt, danach gibt es leider keine verlässlichen Aufzeichnungen mehr.



Man sieht ein gepflegtes Anwesen, sauber abgeputzt, Blumenrabatten und Springbrunnen vor dem Gasthof, damals „Konzert- und Ballhaus“ genannt. Der Saal mit Bühne konnte sich auch sehen lassen. In Kändler dürfte wohl damals kulturell etwas los gewesen sein. Die Einwohner von Kändler waren offensichtlich stolz auf ihren Heimatort. An Freunde und Bekannte verschickte man gern Grußkarten.
Die Ära des Kaiserhofes war mit dem Ende des zweiten Weltkrieges vorbei. In den Nachkriegswirren dachten die Leute zunächst nicht an Konzerte und Bälle. Es ging um das einfache Überleben. Was tun? Was ist machbar? Wohnraum war knapp viele Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten waren unterzubringen. So wurde unter dem Saal und im Gebäude rechts Wohnraum geschaffen.
Die damaligen Verantwortlichen in der Gemeindeverwaltung versuchten trotz aller Trostlosigkeit den Einwohnern Mut zu machen, denn es galt, das Land wieder aufzubauen. Neben der Arbeit sollte den Menschen Abwechslung, Entspannung, Freude und Optimismus offeriert werden. So nahm die Idee „Kulturhaus Kändler“ Gestalt an. 1948 wurde noch mal eine Schankgenehmigung an einen Gastwirt erteilt, doch das war nicht von Dauer. So wurde der „Kaiserhof“ zum „Kulturhaus“ umgestaltet.


Anfangs musste sich die „Kultur“ noch etwas gedulden. Das neugestaltete Schulwesen (Kändler hatte neben der Schule an der Hauptstr. noch ein zweites Gebäude an der Kirchstraße) erforderte eine Schulspeisung für alle Schüler und Schülerinnen. So wurden in den unteren Räumen die Schulküche und der Speisesaal eingerichtet. Der Verfasser kann sich erinnern, dass in den 1950/60er Jahren Frau Brangs und Frau Zingel täglich aus frischen Zutaten ein schmackhaftes Essen „gezaubert“ hatten. Bei den damaligen Versorgungsengpässen kein leichtes Unterfangen.
Im und vor dem Haus spielte sich das gesellschaftliche Leben ab. Zweimal im Jahr fand ein Rummel statt. Ein Kettenkarussell, eine Losbude und eine Schießbude. Eis gab es nebenan die Kugel für 15 Pfennig in der Milchhandlung Arnold, daneben beim Bäcker konnte man Gebäck, zum Beispiel Wasserbrezeln für 5 Pfennig das Stück erstehen.
Im Saal spielten Jugendtanzorchester zum Tanz auf. Die Generation Ü-60 wird sich vielleicht noch an die „Dixis“ und „Dianas“ erinnern. Der Landfilm kam jeden Dienstag. Der „Augenzeuge“ in der „Wochenschau“ als Vorspann war fast die einzige Möglichkeit Weltgeschehen in bewegten Bildern zu verfolgen. Fernseher gab es nur wenige. Mit der Auflösung der Bezirksfilmdirektionen (BFD) im Juni 1990 war das Aus für den Landfilm besiegelt.
Man traf sich zum spontanen Stelldichein (Meeting, Date) oft vor dem Gebäude, sprach über dies und das, sogar in vollständigen Sätzen, man hatte dabei Blickkontakt, d.h. man musste heraus aus der warmen Stube. Smartphone, Smileys, Emojis, Whatsapp, SMS, Facebook, Twitter, Instagram usw. „halfen“ uns noch nicht bei der Kommunikation, welche damals aus genannten Gründen „sehr aufwendig“ war. Aber es war klasse, super, prima, ausgezeichnet, nicht kuhl (cool) oder geil, wie die heute für fast alles benutzten Universaleigenschaftswörter. Und etwas besonders Außergewöhnliches war nicht affengeil, sondern „das gibt’s doch in keinem Russenfilm“ wie wir sagten. Denglisch war absolut unbekannt. Inzwischen wird es ratsam sein, einen Englisch-Kurs zu besuchen, um seine deutsche Muttersprache auch künftig verstehen zu können.
Wir haben uns auch nicht vorstellen können, dass unsere Sprache mal mit Sternchen und Sprechpausen versehen werden muss, um die Gleichberechtigung von Mann und Frau „durchzusetzen“. Das war überflüssig, weil unsere Frauen gleichberechtigt waren. Die Sprache muss jetzt gendergerecht sein. Frauen hinderte niemand Schlosser, Arzt, Wissenschaftler u.ä. zu werden. Nach erfolgreicher Ausbildung wurden sie u.a. Ärztin genannt, nicht „Ärzt*in“ oder „ÄrztIn“, weil es damals keinen „Ärzt“ gab...
Einfach in der Clique das Dorfgeschehen zu verfolgen genügte uns. Fitnessstudio? Wozu? Wir waren immer fit. Der Sportverein hatte viele aktive Mitglieder, die im Wettkampfgeschehen der Region gut mithielten. Auch die Freiwillige Feuerwehr konnte sich nicht über eine genügende Anzahl von Kameraden beschweren. Ein Höhepunkt (Highlight) eines jeden Jahres waren die legendären Feuerwehrbälle im Kulturhaus. Wenn die „Großolbersdorfer“ aufspielten, ist der Saal stets ausverkauft gewesen.
Die Bushaltestelle war sehr stark frequentiert.Vor allem in der Hauptverkehrszeit. Die Werktätigen arbeiteten in großer Zahl in Karl-Marx-Städer Großbetrieben. Sie brauchten nicht ihren nachts in der Garage ruhenden PKW morgens zur Arbeitsstelle transportieren, um ihn nach der Arbeit wieder zu Hause abzustellen, weil man keinen fahrbaren Untersatz hatte. Wenn nach über zehn Jahren Wartezeit dann ein Trabbi zum Haushalt gehörte, nutzte man diesen für Wochenend- und Urlaubsfahrten. Zur Arbeit fuhren die Leute mit Fahrrad, Moped, Motorrad oder bequem mit dem Bus, wenn sie nicht zu Fuß in einem der vielen Betriebe im Ort beschäftigt gewesen sind.
Anfangs gab es nachkriegsbedingt exotisches, „rollendes Bus-Material“ zu beobachten. Alte Büssing, Vomag oder Lowa-Busse, einmal fuhr sogar ein Doppelstockbus. Der Gaubschat hatte sogar eine durchgehende Verbindung vom Triebwagen zum Anhänger. Heute steht er im Fahrzeugmuseum Hartmannsdorf. Auch Busse mit Anhänger waren nichts Ungewöhnliches. In der Anfangszeit versah jeweils ein Schaffner im Triebwagen, der andere im Anhänger seinen Dienst. Später gab es nur noch einen Schaffner für beide Abteile. Mit dem Einsatz der modernen, ungarischen Ikarus-Busse wurde auch dieser Arbeitsplatz eingespart und die Kassierung übernahm der Busfahrer gleich mit. Auf ein seltenes „Vorkommnis“ soll noch hingewiesen werden, denn es passierten manchmal seltsame Dinge: So boten im Bus oft jüngere Fahrgäste Älteren ihren Sitzplatz an. Unvorstellbar, aber das gab es wirklich!
Nach der politischen Wende erlahmte das Interesse an einem kulturellen Zentrum im Ort. Die weite Welt stand jetzt offen, das Kulturhaus dafür leer, verfiel und ihm wurde das Schicksal vieler historischer Gebäude zuteil: Kein Interesse, Erhalt zu teuer, Abriss. Die Genehmigung zum Abbruch erfolgte am 4.10.2000 – zum 22.03.2001 war die Sache erledigt.


Auf der freien Fläche entstand ein Spielplatz. Davor befindet sich ein Parkplatz, die Haltestelle der Buslinie nach Chemnitz ist erhalten geblieben.


Es wäre gut, wenn Haltestelle und Buslinie nicht das Schicksal des Kulturhauses ereilen würde. Denn nach dem „Chemnitzer Modell“ soll ja wieder eine Bahnverbindung („Straßenbahn“) nach Limbach errichtet werden. Vielleicht „in etwa 10 Jahren“ berichtete die „Freie Presse“ am 6.8.21 auf S. 15, wobei eine Entscheidung zum Trassenverlauf „nach Angaben des Rathauses bis Anfang kommenden Jahres“ getroffen werden soll.
Dabei ist unter anderem an die Nutzung der alten Gleisanlagen gedacht, die Kändlers Ortsrand am Tännigt streifen. Vielleicht gibt es dann dorthin einen Zubringerbus – elektrisch, oder es kommt noch ganz anders, denn während heutiger ellenlanger Planungszeit (Vgl. „Mein Kändler“ 04/2020, S.9 ehemalige Bahnline Kändler … 12 km, 1896, Bauzeit 3 Jahre!) wird noch viel Wasser den Pleißenbach hinabfließen.
Michael Sieber
Danke an die Unterstützer Herr Bohmann (Stadtarchivar), Frau Pfeiffer, Herr Kurth, Frau Kreßner, Herr Roßmeisl u.a. für die Bereitstellung von Informationen und Fotos.
Vor 100 Jahren baute die Gemeinde Oberfrohna ihr drittes Wasserwerk aus
Vor 100 Jahren baute die Gemeinde Oberfrohna ihr drittes Wasserwerk aus

Beschaffung von lebenswichtigem Wasser ist Voraussetzung jeglicher menschlicher Ansiedlung. Schon immer bevorzugte man dabei Grundwasser: Bereits im Alten Testament nannte man es lebendig. Als totes dagegen bezeichneten die Völker dort in Zisternen gesammeltes Niederschlagswasser. Es war unter den Klimaverhältnissen in der Gegend dieses Handelns das für die Bevölkerung oft nur vorhandene. Schon seinerzeit gab es technisch ausgeklügelte Lösungen. Immer dichtere Besiedlungskomplexe schafften sich dann Anlagen zum Gemeingebrauch. Entsprechend technischer Fertigkeit und verfügbaren Materialien waren das der Schwerkraft unterliegende Freigefällesysteme. Mit steigenden Fähigkeiten in der Rohrfertigung kam man bereits in griechischer und römischer Antike auf Druckleitungen. Ebenso früh waren Hebesysteme unter Ausnutzung von Wasser- und Windkraft entwickelt worden. Ab spätem Mittelalter verfeinerte man das maschinelle Pumpen. Dampfkraft kam zu Beginn des 19. Jahrhunderts und dann Elektroenergie ab 1890, bei uns in Limbach und Oberfrohna 1907 auf. Bereits 1783 fertigte das Eisenwerk Lauchhammer (Detlev Carl v. Einsiedel) durch dort mit entwickelte bessere Fließfähigkeit des Materials gusseiserne Rohre in Serie. Verbindungen erfolgten geflanscht oder gemufft. Die Wasserverteilungssysteme erreichten Obergeschosse der Gebäude. Seit Aufnahme der nahtlosen Rohrfertigung durch die Gebrüder Mannesmann bis 1890 sowie Erkenntnissen zur Korrosionsverhinderung bei der Erdverlegung durch bituminösen Außenschutz kamen Stahlrohre zum Einsatz. Für die Löschwasserbereitstellung entwickelte man Hydranten. Kreiselrad- auch als Zentrifugalpumpen bezeichnet, ersetzten dann die Kolbenpumpen. Etwa ab 1840 wurden in deutschen Landen öffentliche Wasserversorgungen der Kommunen auf dieser Basis ausgebaut, meist neu errichtet. In Limbach war das 1892 und in Oberfrohna 1905. Infolge zunehmender Industrialisierung und verbunden mitkommunalen Ausbau stieg der Bedarf steil an. Man musste weitere Wassergewinnungsgebiete erschließen und das möglichst territoriumsnah.
Oberfrohna kaufte dafür ab 1910 die damals vielen Waldflurstücke bis auf das des Bauern Vogel (Hellvogel) im dann so bezeichneten Gemeindewald zusammen. Unter anderem waren das auf eigener Gemarkung die der Bauern Herrmann Fischer (Gut bis 1937 im Schulgarten) und Landgraf (Oberer Gutsweg abwärts neben Gerhart-Hauptmann-Schule, Reste noch bis 1964 zu sehen). Wasser gehörte seinerzeit zum Grundstückseigentum.
1911, in einem sehr trockenen Jahr, erwarb die Gemeinde noch die Wasserrechte in Eschen‘s Wiese auf Rußdorfer Flur am bereits seit 1903 vorhandenen Sonnenbad. Schon im Talansatz von Osten nach Süden weiter oben trat dort Grundwasser flächig aus. Ein Teil davon auf Oberfrohnaer Flur diente dem Sonnenbad als Zulauf.
Der Bereich war schon viel früher als gute Quelle bekannt, wie Horst Strohbach in Geschichte und Überlieferung des Bauerntums zu Oberfrohna Seite 33 erwähnt:
Der heute noch auf Otto Fichtners Gut (jetzt Lindner, Oberfrohna) stehende einzelne Kirschbaum ist der letzte Rest einer ganzen Kirschenallee (Johanniskirschen), die bis hinter ans Holz ging, fast in die Nähe der halbverfallenen Holzwächterhütte am Rußdorfer Weg, in der der „Pfau-Lieb“ hauste. Dicht dabei, beim heutigen Eingang des Sonnenbades Rußdorf, lag auch die sumpfige Wiese mit vieler Bornkresse. Vom niederen Zaunende her, wohl 5 m, auf Oberfrohnaer Flur quoll auch einst der Buchenborn. Dort holte der Pfau-Lieb sein Wasser.
Nach dem Ersten Weltkrieg konnte Oberfrohna dann dort den weiteren Ausbau ihrer Gemeindewasserversorgung in Angriff nehmen:
Zunächst geschah das 1919 zur Wassergewinnung durch eine Quellfassung mit Sicker- und Vollrohren sowie Kontrollschächten dazwischen. Ihr Verlauf ist entlang des Sonnenbades von oberhalb bis zur großen Eiche nach dem Naturheilvereinsgelände. Neben dem vorläufigen Endschacht erstellte die Freiberger Fachfirma August Löffler ein provisorisches Pumpwerk in einem kleinen Schuppen. Dazu verlegte man dichter entlang der Landesgrenze auf Altenburgischen Gelände (Ausland) eine Förderleitung DN 150 Mannesmannstahlmuffenrohr hoch bis zur Waldenburger Straße. Dort verlief auf Oberfrohnaer Seite (links in Richtung Höhe) seit inzwischen 14 Jahren die Fallleitung vom Hochbehälter der „Oberen Zone“ nach dem eigentlichen Gemeindegebiet. Diesen mit 350 Kubikmeter (m³) Inhalt hatte die Gemeinde seinerzeit auf Flur Meinsdorf am Südende der Meinsdorfer Straße auf dafür erworbenen Grundstück errichten lassen. Er bestimmte den Verorgungsdruck im überwiegenden Gemeindegebiet. Die so 1919 gewonnene Tageskapazität betrug 130 m³.
Nach einem Jahr der Beschaffung von Finanzmitteln dienenden Pause baute sie ihr Wasserwerk im Gemeindewald weiter aus:
die Quellfassung anschließend bis runter in den Nordwestteil des Waldes
dort ein Pumpwerk mit Sammelreservoir von ebenfalls 350 m³ Inhalt
gleichzeitig die Förderleitung parallel verlegt und Anschluss an die oben bereits vorhandene.
Diesen Auftrag für den zweiten, größeren Teil hatte Oberfrohna nach einem Ausschreibungsverfahren diesmal der Fa. Otto Silbermann, auch aus Freiberg, übertragen. Otto Silbermann war ungefähr bis Ende des Ersten Weltkrieges Oberingenieur bei August Löffler. Ihn kannte man in der Gemeinde also schon vom Erstausbau und dem 1908/09 folgender Erweiterung des Oberfrohnaer Wasserwerkes im Frohnbachquellgebiet.
Allerdings erhob Bräunsdorf nun Einspruch. Dort sah man sich der Möglichkeit benommen, das auf ihrer Flur an- und für den Ort ausreichend hoch liegende Quellwasser für eine eigene Gemeindewasserversorgung zu nutzen. Im darauffolgenden Wasserrechtsverfahren, seit 1909 gab es das Sächsische Wassergesetz, sollte der Ort einen Teil des Wasseraufkommens im Gemeindewald erhalten. Das aber nur, sobald er in der Lage war, ein eigenes Verteilungssystem auszubauen. Bräunsdorf schaffte das wirtschaftlich bis 1930 nicht, obwohl es rohrtechnisch im Pumpwerkskeller bereits vorbereitet war. Erst 1930/31, mit dem weiteren Ausbau der Oberfrohnaer Wasserversorgung durch Fassen neuer Grundwasservorkommen im Folgental (Quellfassung, 2 Tiefbrunnen) leistete Oberfrohna den Aufwand für das zum Durchfördern reichlicher dimensionierte Netz (Wasserrechtserwerb auf Fluren von fünf Gütern, Durchleitungsverhandlungen am 9. November 1929 abends im Gasthof „Linde“). Bräunsdorf musste nur noch Leitungsabschnitte im Niederdorf sowie die Hydranten finanzieren. Nach dem Ausbau in Bräunsdorf wurde durch den Ort in das Sammelreservoir Gemeindewald gepumpt, sofern die Ergiebigkeit der anderen Oberfrohnaer Gewinnungsanlagen zurückfielen.
Die 1923 eingerichtete Kinderwalderholungsstätte im Südwesten des Gemeindewaldes auf Bräunsdorfer Flur sowie die im gleichen Jahr gegründete Gartenanlage Einigkeit am Gemeindewald (im Gebrauch dann „an der Rewenselschänke“) erhielten jeweils einen Anschluss von der Förderleitung aus. Zu der Zeit endete das nächstgelegene Wasserrohrnetz noch in der Wolkenburger Straße.
Nun verwende man auch mal einen Gedanken an die von der Fachfirma zu betreibende Logistik unter den damaligen Bedingungen:
Der Tiefbau für Fassungen, Förderleitung und Pumpwerk im Gemeindewald erfolgte den Sommer über als Akkordarbeit mit ungefähr 40 Mann in reiner Handarbeit. Das bedeutete, die bis zu 3,5 m tiefen Fassungsgräben sowie die noch tieferen Baugruben für die Kontrollschächte dazwischen mussten mit Holzausbau gegen Einstürzen gesichert werden. Der Aushub erfolgte mittels Zwischenbühnen und Absetzen (Umschaufeln) oben, also drei Mann arbeiteten übereinander. Schachtringe wurden zur Baugrube gerollt und mit Dreibock eingelassen, ebenso dann die Rohre der Förderleitung. Das in den Graben eintretende und darin ablaufende Grundwasser musste beim Verstemmen der Muffen, bei Fassungssträngen aus Steinzeug mit Strick und Teer-, in den Druckrohren nachgeschlagener Bleiverguss mittels Handpumpen, vorübergehend sohlnah gehalten werden. Bodenbereiche mit vielen Granulittrümmern wurden angetroffen. Zwei Mann waren deshalb mit Schubkarren täglich zur Liebert-Schmiede in Oberfrohna an der damaligen Hauptstraße unterwegs, um die Hacken schärfen zu lassen. LKWs kamen erst auf. Vom Bahnhof Oberfrohna erfolgte der Rohr- und Schachteiletransport durch örtliche Fuhrunternehmer mit Pferden per Langwagen in den Wald. Die Stahlrohre maßen 6 m. Deren bitminöse Umhüllung erforderte dabei besondere Achtsamkeit, sonst bestand Lochfraßgefahr. Schachter kamen aus dem Ort bzw. der Umgebung, Rohrleger aus Freiberg. Die blieben die ganze Woche, übernachteten in Oberfrohna. Zur Baustelle und zurück liefen die Männer. Für Pausen und Werkzeuglagerung standen pferdegezogene Bauwagen mit eisenbeschlagenen Holzrädern zur Verfügung. Bei Errichtung von Sammelbehälter und Pumpwerk verwendete man Baubuden. Aber hier fanden bereits von Dieselmotoren getriebene Mischanlagen Verwendung. Samstags wurde bis 16 Uhr gearbeitet.
Wenigstens gab es für solche Leistungen beim Ausbau der Infrastruktur bereits Finanzzuschüsse aus der Arbeitslosenhilfe des Landes Sachsen.
Zweimal sogar legten die Arbeiter kurz die Arbeit nieder. Hintergrund war, dass der damalige Stundenlohn nach dem Ersten Weltkrieg, einer Zeit mit viel Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Verwerfungen, inflationsbedingt täglich steigenden Lebenshaltungskosten gegenüber stand.
Im Pumpwerk kam zunächst nur eine Pumpe mit 65 m³/h Fördermenge und 75 m Förderhöhe zur Aufstellung. Der bisher alleinigen Hochquellenversorgung floss in wasserreichen Jahreszeiten den beiden Oberfrohnaer Druckzonen ausreichend Wasser zu. Dann musste das Förderaggregat nicht laufen. Seinerzeit schon ging man sparsam mit Elektroenergie um.
In diesem bis 1926 als 1. Phase zu bezeichnenden Ausbau des Oberfrohnaer Wasserversorgungssystems stand in der Wasserwerkskasse eine Verschuldung von 10.849 Mark einer jährlichen Einnahme von 42.391 Mark gegenüber. 1928 wurden dabei rd. 300.000 m³ verkauft. Allerdings kam es ab dem Jahr zu einem deutlichen Rückgang infolge Umstellung des Gemeindeelektrizitätswerkes auf vorrangigen Fremdstrombezug. Damit reduzierte eigene Stromerzeugung benötigte dann jährlich ungefähr 5.000 m³ weniger Kühlwasser.
Die Elektroenergie gelangte zuerst per Freileitung in das Pumpwerk.
1928 wurden Trafostationen der Orte Bräunsdorf, Strumpffabrik und Rußdorf, Welkers als 5 kV (5000 Volt) Starkstromring vom Eltwerk Oberfrohna über die Wolkenburger Straße und dem Wasserwerk erschlossen. Das erhielt rechts des Maschinenraumes einen Anbau für die Trafostation. Die zweite Pumpe, ebenfalls von der Firma Klein, Schanzlin und Becker Frankenthal/ Pfalz (jetzt KSB) mit 55 m³/h wurde angeschafft und vor allem bemerkenswert, eine Fernmess- und Fernsteueranlage der Dresdner Firma Bloch, dann AEGIR eingebaut. Weil das seinerzeit Kabelverbindung erforderte, ließ die Gemeinde ein Fernmeldekabelsystem verlegen. Das verband den Hochbehälter auf Flur Meinsdorf, eine neu errichtete Hilfspumpstation an der Waldenburger Straße hinter der Nr. 78 auf Oberfrohnaer Flur für dort hochgelegene Gebäude, und das Wasserwerk im Gemeindewald mit dem Oberfrohnaer Rathaus. Eine Vorstellung vom Aufwand: 4.000 m 8- und 12-adriges Kabel erdverlegt.
Im Kellergeschoß, dem Sitz des Ortsbauamtes, stand die hellmarmorne Instrumententafel mit Messing gerahmten Anzeigen und Schaltern. Die Pumpen ließen sich von dort aus zuschalten, wenn der ebenfalls angezeigte Hochbehälterstand das erforderte. Vielleicht mit interessant: Deren Motoren wurden zur Vermeidung eines Spannungszusammenbruches bei Direkteinschaltung mittels handradbetätigten Anlasser sanft angefahren. Jetzt für den Automatikbetrieb nahm statt Handregler ein Anlassermotor über ein Schneckengetriebe die Widerstandsveränderung vor.
Dabei bedingte Zeitabläufe wurden über eine Art Uhrwerk geregelt.
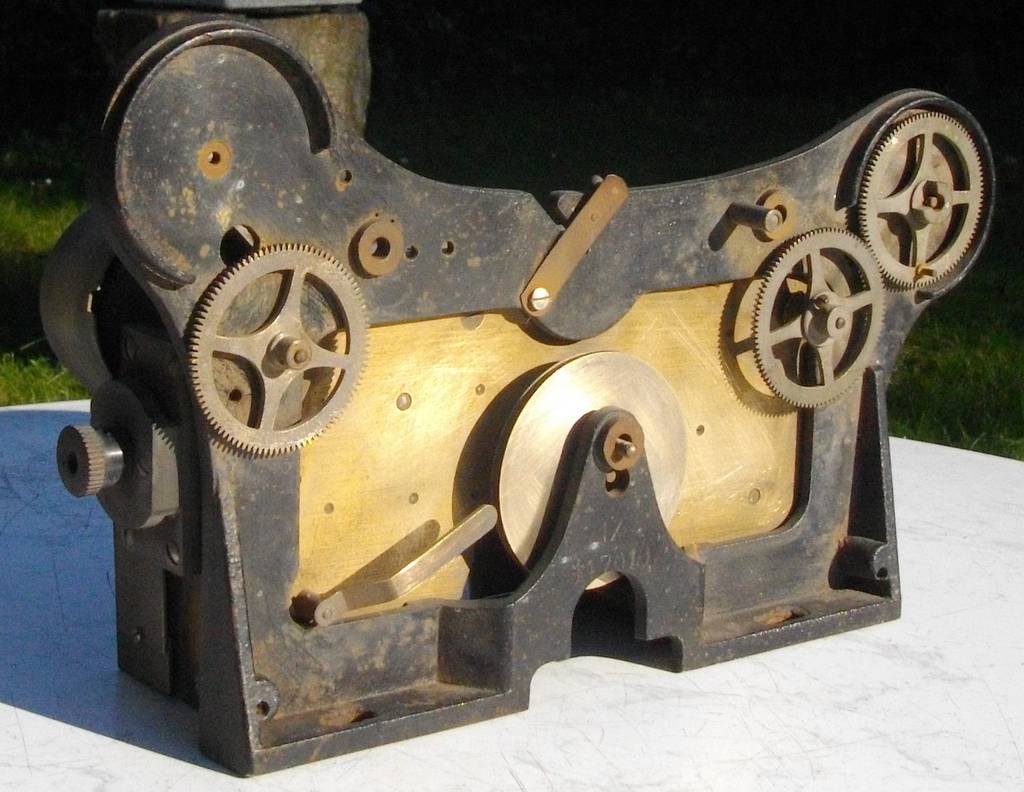
Überhaupt: Oberfrohna versorgt seit 1926 Mittelfrohna neben Gas und Strom, auch mit Wasser.
1927 und 1928 baute die Gemeinde ihr Rohrnetz weiter aus:
Über insgesamt 1.975 m Verstärkungsleitung von dem Hochpunkt der Waldenburger Straße entlang dieser, dann dem oberen Gutsweg, Schröderstraße, Karlstraße, Bergstraße, heutige Willy-Böhme-Straße bis zur Lindenstraße. Dazu kamen in weiteren Gemeindestraßen sowie bereits im damals noch selbständigen Rußdorf 2.760 m Wasserleitungen als Erweiterung des Netzes. Zu der Zeit erschloss die Gemeinde großteils auch das Gartenstadtviertel beidseits der heutigen Rußdorfer Straße mit, Stadtgas, und Strom, dazu gehörig Kanäle zur Entsorgung, schließlich Straßenbau. Der Tiefbau erfolgte noch immer von Hand. Mit jeder Erweiterung stieg der Wasserbedarf.
Bei fortschreitenden Betrieb öffentlicher Wasserversorgungen bildeten sich Erkenntnisse auch zur Wirkung von Grundwasserinhaltsstoffen auf Rohre sowie letzendlich bei den Verbrauchern heraus. Aufbereitungstechnologieen wurden entwickelt. Solchen Handlungsbedarf erkannte entsprechend auch Stadtbaumeister Oswin Haas (Oberfrohna seit 1935 Stadt) für die Zuläufe aus den Pleißaer Quellen sowie für die im Stadtwald. Nach Beratung durch den schon seit den 1927er Vorhaben für Oberfrohna als Planer tätigen Zivilingenieur Ernst Österreich aus Dresden kam es 1937 daraufhin zum Aufbereitungsbau. Der Oberfrohnaer Baubetrieb Hans Thieme an der heutigen Körnerstraße, jetzt Baugeschäft Granz, errichtete am Pumpwerksgebäude ein offenes Filterbecken in einem unmittelbaren Anbau links.
Die Abgangshöhe im Hauptsammelschacht, unterster der Quellfassung sowie das Niveau des Sammelreservoirs ließen bei Freigefälledurchlauf diese Anordnung zu. Mittels waagerechtem Gerinne wurde das Quellwasser auf das darunter eingebrachte Filtermaterial verteilt. Zur Entsäuerung, Enteisenung und Entmanganung, wurde fein gekörnter Kalksteinsplitt (Decarbolith) eingesetzt. In Voraussicht hatte sich Oberfrohna 1944 (Zweiter Weltkrieg, Luftschutzmaßnahmen) sogar reichlich damit eingedeckt. 1945 konnte ein kleiner Teil davon nach Pleißa für deren Anlage am Tiefbrunnen beim Großen Teich abgegeben werden.
Das Wasserwerk im Gemeindewald kam gut über die Kriegszeit. Nur der Bombenwurf am 6. Februar 1945 traf unterhalb vom Rosenhof das dort im nördlichen Fußweg der heutigen Rußdorfer Straße verlegte Steuerkabel.
In der Zeit danach kam es immer wieder zu Stromausfällen und damit stundenweisen Pumpenstillstand. Mengenmäßig konnte das in der Regel durch die über den täglichen Zulauf höhere Förderkapazität aus dem reichlich bemessenen Sammelreservoir abgefangen werden. Sowieso wirkten beide Oberfrohnaer Hochbehälter. Der auf Flur Meinsdorf war zudem 1930 um 650 m³ Speichervolumen erweitert worden. Allerdings fiel die Fernsteuerungstechnik immer mehr aus. Ersatzteile gab es kaum. Dann in den 1960ern funktionierte im ehemaligen Oberfrohnaer Rathaus nur noch die Anzeige.
Mit dem Ausbau des Wasserwerkes Folgenbach durch Oberflächenwasseraufbereitung musste auch im Stadtwaldwasserwerk die Förderkapazität erweitert werden. Auftragsvergaben erfolgten seinerzeit nicht mehr nach Ausschreibung sondern im Rahmen einer bezirksgeleiteten Zuordnung von Baukapazitäten. Ab Winter 1970 verlegte der seit 1964 zuständige VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Karl-Marx-Stadt (VEB WAB) eine neue Förderleitung in DN 200 AZ (Asbest-Zement) bis hinauf zur Straße der OdF (heute wieder Waldenburger Straße).

Ein Abzweig führte zum Leitungsende in der heutigen Rußdorfer Straße am Schreberweg. Die bauvorbereitende Planung kam aus der technischen Zentralverwaltung des Versorgers. Freischneiden der Trasse im Wald erfolgte durch die beiden Oberfrohnaer Rentner Konrad Oberländer und Erich Oehme. Sie arbeiteten als örtliche Helfer des Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes Flöha. Mit damals nur verfügbaren Handsägen war das noch zu bewältigen, weil der Verlauf überwiegend in Bereichen außerhalb der Wiederaufforstung neben den Wegen erfolgen sollte. Die wiederum beruhte auf Brennmaterialknappheit und meist illegalen Auslichtungen im Gemeindewald nach dem Zweiten Weltkrieg. Von Bräunsdorf konnte man die Rußdorfer Gebäude sehen, erzählten die Älteren. Den Tiefbau brachte die Richard Vogel KG, Sitz in der Arno-Förster Straße 44 (heute A.-Einstein-Straße), Betriebsleiter Harry Unger. Die Arbeit der Handschachter übernahm jetzt ein Traktorbagger Belarus und Schüttgütertransporte ein dreiachsiger zum Kipper umgerüsteter und gasangetriebener (Propan/Butan) LKW des Types SIS (Sawod imeni Stalina), beides sowjetische Produktion. Dabei führte ein ungenauer Bestandsplan zum Zerreißen des Hochspannungskabels westlich vom Inselteich, glücklicherweise ohne Personenschaden. Die gewichtsmäßig schwere Rohrverlegung nahm das jüngere Personal des Meisterbereiches Limbach-Oberfrohna vom VEB WAB unter Meister Günter Fischer (seit 1954) vor .
Da die neuen Förderaggregate GLA 100/4 des Herstellers VEB Apollowerk Gößnitz stärkere Motorleistung besaßen, war auch eine höhere Trafoleistung erforderlich. Der kam in einem gesonderten Typenbau rechts daneben unter. Während des Umbaues ließ der nun verbrauchsbedingte Dauerbetrieb keine längere Außerbetriebnahme zu. Die jüngere der bisherigen Pumpen musste daher fast durchgehend laufen, während bereits anstelle der anderen eine neue eingebaut wurde. Pumpenfundamente, Maschinen und die Rohrtechnik montierten Mitarbeiter des Meisterbereiches. Elektrotechnisch arbeiteten in den Bereichen Starkstrom ein Lichtensteiner Fachhandwerksbetrieb, bei Arbeitsstrom der vom Elektroingenieur Wolfgang Pester aus Limbach-Oberfrohna. Steuerungsseitige Leistungen brachte die Spezielwerkstatt des VEB WAB. Eine vom Hochbehälterstand ausgehende Förderung war über das noch funktionsfähige Kabel eingerichtet worden.
Auch der Pumpenbau lief vor 1990 kontigentiert. Infolge standen nur Aggregate zur Verfügung. die den Förderbedingungen nur annähernd entsprachen. Ein gewisses Sicherheitsdenken kam hinzu. Die Pumpen mussten gedrosselt werden. Um 2,5 bar sowie 20 m³/h erhöhte, aber eigentlich nicht verwertbare Förderleistung bedingte eigentlich unnötiges Mehr an Stromverbauch. Zu der Zeit hatte das aber nur nachgeordnete Bedeutung. Ein geringer Preis des Lebensmittels Nr. 1 erzeugte sowieso hohen Verbrauch in Oberfrohna und Niederfrohna. Mit mehr Wasser aus dem zuvor seit 1962 wesentlich erweiterten Wasserwerk Folgenbach wurde dazu eine Teilmenge aus der Druckzone Oberfrohna in die 18 m höhere von Limbach mit dem Wasserturm als druckbestimmender Hochbehälter weiter gefördert. Die Pumpen im Wasserwerk Stadtwald liefen durch.
Nach Wiedereinführung von Wettbewerbstrukturen ab 1990 war auch besser angepasste Fördertechnik verfügbar. Die Landkreisbehörde verfügte 1994 Herausnahme der Oberflächenwasseraufbereitung im Wasserwerk Folgenbach mit Folge eines geringeren Durchsatzes. Dementsprechend angepasste Maschinen wurden 1997 im Stadtwald eingebaut. Zugleich stand wieder und besseres Aufbereitungsmaterial zur Verfügung. Das seit 1937 zur Rückspülung des offenen Filters genutzte, lautstarke Walzengebläse wurde noch durch ein geräuschgedämmtes ersetzt. Bis dahin hörte man das alte bei jeden Rückspülvorgang auf der Oberen Dorfstraße in Bräunsdorf.
110.000 m³ lieferte die Quellwasserfassung im Gemeindewald jährlich. Aufgrund Abnahmeverpflichtung aus dem Fernwasserversorgungssystem musste jedoch die Netzeinspeisung aus örtlicher Gewinnung im Jahr 2000 auf die knappe Hälfte zurück gefahren werden. Ab 2002 war auch das noch zu viel. Dazu erklärten die Fachbehörden das Vorkommen als nicht mehr schützbar. Oberhalb vom Gemeindewald hielt sich die dort bearbeitende Landwirtschaft nicht unbedingt an amtliche Vorgaben für solche Trinkwassereinzugsgebiete, obwohl sowieso Nutzungsausgleich für mögliche Ertragsminderung dafür gezahlt werden musste. Das Sonnenbad hat man seit 1978 in seiner Liegefläche nach Südwesten auf Rußdorfer Flur und damit über die darunter liegenden Fassungsanlagen erweitert. Sein in den Bräunsdorfer Bach durch den Wald ablaufendes Beckenwasser entsprach ebenso nicht diesen Schutzvorgaben. Dazu gab es derzeit noch Probleme mit der Dichtheit vom Abwasserkanal in der Straße am Gemeindewald, also im Anstrombereich der Quellen. Im Fazit stimmten unsere damaligen Stadträte mehrheitlich der von dem Landkreis sowie dem jetzt zuständigen Trinkwasserversorger in Glauchau vorgeschlagenen Außerbetriebsetzung dieser Wassergewinnung zu.
Das Wasserwerk im Gemeindewald, wir nannten es wie von unseren Vorgängern überliefert, weiter Stadtwald, wurde 2006 zurückgebaut.
Den Altteil der Fassungen bis zur großen Eiche am Dreiflurenstein übernahm unsere Stadt fürs Sonnenbad. Unten ist noch ein Teil erhalten, um die Vernässung des Wasserwerksweges zu verhindern.
Aus gewässerökologischer Sicht positiv: Seit dem Rückbau der Fassungen läuft wieder ganzjährig ab unterhalb des Sonnenbades Wasser im Oberlauf des Bräunsdorfer Baches.
Unser Wasser - das Eigentums- und Wertebewusstsein einer übersehbaren Kommune früher, ist nun auch in Limbach-Oberfrohna verschwunden. Andere, moderne Reize dazu digital noch potenziert, wirken eben heute auf die Bürger von allen Seiten ein. Nur Überreizte, einige mit ihren Kindern oder Hunden, suchen immer mal die Ruhe des Waldes. Vielleicht kann man dieses Bedürfnis aufnehmen:
Am Inselteich würde sich die Gelegenheit bieten, Quellwasser, Teiche und Wald für Jedermann erholend dazu mit gesundheitsfördernder Wirkung sowie Spiel und Unterricht darzustellen. Aufwand dafür erscheint im Vergleich zu anderen kommunalen Vorhaben auch vertretbar.
Reinhard Käferstein
Ein Rundgang durch Pleißa
Ein Rundgang durch Pleißa
In der Festschrift „50 Jahre Stadtrecht Limbach-Oberfrohna“ von 1933 hat Horst Strohbach einen aufschlussreichen Beitrag über Pleißa veröffentlicht. Michael Nessmann, Vorsitzender des Heimatvereins, hat diesen „ausgegraben“ und unter anderem auf einer Tafel an der neuen Sitzgruppe am Baumgartenweg anbringen lassen.
Eine sehr schöne Wanderung bietet ein Rundgang durch das idyllisch am Fuße des Totensteinhöhenzuges gelegene Pleißa. Ein herzhafter Volksmund, wohl aus längst verrauschten Zeiten, wußte einst boshaft zu erzählen: „Wanderer, wenn du von Langenberg über Pleißa nach Kändler in übermütiger Weiße deine Schritte lenkst und bist unterwegs nicht ausgeplündert oder halb totgeschlagen worden, so knie nieder, bete ein Vaterunser und gelobe feierlich: Ich wills nicht wieder tun!“
Diese Worte entstammen nach mündlicher Ueberlieferung irgend einer Nachkriegszeit früherer Jahrhunderte, in der Plünderer die hiesige Gegend unsicher machten. Später, besonders in den politisch erregten Jahren nach dem Weltkriege, ist Pleißa ein bezeugt ruhiger Ort gewesen, sicher ein Verdienst seines energischen Oberhauptes.
In der Meißner Jurisdiktionsmatrikel wird Pleißa zum ersten Male im Jahre 1346 genannt und zwar als Kirchdorf. Am 13. Dez. 1375 verkauften die Edlen von Waldenburg, denen die reichsunmittelbare Wirtschaft Rabenstein mit Pleißa und einigen anderen Dörfer gehörte, Pleißa mit an das Benediktinerkloster in Chemnitz. Diese Abhängigkeit Pleißas endigte 1540 mit der Einführung der Reformation. 1879 zählte Pleißa 2400 Einwohner und heute über 3200. Sein Gemeinde-Parlament ist von 12 Mitgliedern der NSDAP besetzt.
So komm, lieber Heimatpilger, und wandere mit, auf einem Spaziergang durch Pleißa alter Erinnerungen zu pflegen. Pleißa hat seinen Namen als erstes Dorf im Pleißenbachtale von dem auf der Langenberger Waldhöhe entspringenden Pleißenbache erhalten. Der Name selbst stammt von dem sorbischen Plisni, das soviel wie Pfütze, Tümpel, Sumpf bedeutet. So weißt die Entstehung des Namens auch auf die vielen Teiche und Sümpfe früherer Zeit im Pleißaer Grund hin.
Beginnen wir nun unsern Rundgang von Kändler her. Bald stehen wir vor einem hellgeputzten Doppelgut, dem „Lindenhof“, wie es vor einem Jahr sein neuer Besitzer kaufte. Schauen wir durch das Hoftor, so erfreut uns die Erhaltung alter Bauweise: ein überdachter Laubengang und ein ebenso überdachte Treppenaufgang. Dies bezeugt, dass Pleißa einst genau wie Limbach durch rheinfränkische Siedler gegründet wurde. 30 Güter von je ca. 40 Acker sind damals in gleich schöner Bauweise errichtet worden. Doch haben, wie so oft, die späteren Besitzer aus Ersparnisgründen diese schöne rheinfränkische Bauart nicht erhalten.
Nach einer Wegbiegung grüßt das „Gasthaus zur Sonne“, das jetzt unter dem Pächter, Herrn Otto Zschau, ein neues Aufblühen erlebt. Von ihm erfahren wir, dass an dieser Stelle früher eine Flachsbreche stand und dass dem späteren Besitzer nur der Bierausschank genehmigt worden war. Den Hauptverdienst aber brachte der Schnapsumsatz; selbst der Brigadier trank hier gern sein „Zuckerwasser“.
Wir überschreiten nun das erste Mal den Pleißabach, der dann weiter durch Kändler, Röhrsdorf, hinüber in die Gegend der Kaltbrüche (Naturtheater) und durch Rottluff, Altendorf in den Chemnitzer Schlossteich fließt. Zur Rechten liegt die „Klausmühle“, nach einem anderen vorherigen Besitzer auch Berthelsmühle genannt. Es war dies einst bachabwärts die siebente Mühle Pleißas; heute ist keine einzige mehr im Betrieb.
Bald zweigt rechts die schnurgerade Klausstraße ab, von Spaßvögeln gern als Pleißas „Kaßberg“ bezeichnet. Links am Bache steht die einzige Bleicherei des Ortes, die sich schon in dritter Generation in den Händen der Familie Löbel befindet.
Hinter der Löbelbleiche steigt der Krämerberg steil in den Himmel empor. An seinem Fuße sollen früher von Waldenburg her durchziehende Krämer oft ihre Waren zum Verkaufe angeboten haben.
Wir kommen am „Cafe Dietrich“ vorüber. Nach einer weiteren Überquerung des Baches liegt auf gleicher Seite das „Gasthaus zur Post“, den älteren Leuten als „Jochmannschmiede“ bekannt, genannt nach einem früheren Besitzer der zugleich Schmied war. Hinter dem Rathaus wohnt der Klempnermeister Schaarschmidt. In dessen Laden befand sich früher auch ein Lokal mit Bierausschank.
An der nächsten Biegung und Bachüberschreitung zur linken liegt Nitzschens Gut, an dem man noch leicht die frühere „Nitzschenmühle“, eine Mahl- und Schneidemühle erkennen kann. Von dem hinter dem Gute aufsteigenden Wege nach Grüna sieht man noch den Verlauf des alten Mühlgrabens.
Gleich nach dem Delikatessgeschäft von Emil Schmalfuß zweigt rechts die alte „Waldenburger Straße“ ab, die einst hinter der Kirche zwischen den Feldern nach Meinsdorf weiterführte.
Nun richtet sich der Blick auf das 1925/26 erbaute schöne Rathaus.
Das übernächste Grundstück rechter Hand, die Sprangersche Bäckerei, lässt heute schwerlich eine weitere Mühle, ebenfalls eine Schneide- und Mahlmühle, die „Oehmemühle“ erkennen. (Im Jahre 1901 verunglückte der Ehemann der Frau Bertha Köhler, derselben Frau, deren töchterliche Familie bei dem Autounglück am 2. Weihnachtsfeiertag v. J. überfahren wurde, beim Riemenauflegen in der Schneidemühle.) Demnach ist die Oehmemühle die letzte, die in Betrieb war. Der Schuppen auf der rechten Seite, wo Schieferdecker Ackermann seine Schiefer liegen hat, war die Schneidemühle. Es ist nur der obere Dachteil abgenommen worden.
Von der rechten Höhe schaut die 1912 erbaute, bereits schon vierte Schule Pleißas herab. In 10 Klassenzimmern werden gegenwärtig 412 Kinder unterrichtet.
Daneben erhebt sich die alte Kirche, die 1740 geweiht wurde. Sie ist das dritte Gotteshaus, das hier auf dieser Stätte steht. Die beiden früheren Kirchen sind 1513 und 1731 durch Feuer zerstört worden. Schon seit 600 Jahren sind die Bewohner des Ortes auf diese Höhe heraufgestiegen, um ihren Gottesdienst zu halten. Die Kirche zeichnet sich durch eine gute Orgel aus. Im April 1923 wurden drei neue Glocken aufgezogen und im folgenden Mai weihte man das Krieger-Ehrenmal hinter der Kirche an der Staatsstraße.
Unterhalb der Kirche steht die alte Kirchschule, in der sich heute die Kantorwohnung befindet. Das war bereits die zweite Ortsschule. Unter Bürgermeister Berthold, dem die Klausmühle gehörte, wurde die erste Schule niedergerissen und diese erbaut.
Bis vor kurzem lag unterhalb der alten Kirchschule die Ruine der zu Kriegsausbruch abgebrannten Brauerei, die schon einige Jahre vor dem Krieg stillgelegt worden war.
Zu dieser gehörte wieder eine Mahlmühle, die „Lehngerichts- oder Richtermühle“ mit Bäckerei. Schon 1842 ist das Lehnsgericht, zudem früher auch das Rüdiger‘sche Gut gehörte, unter Posthalter Stengel als Besitzer teilweise abgebrannt.
Das Lehngericht war früher der Mittelpunkt Pleißas in vielfacher Bedeutung. In dem noch bis 1932 stehenden Wohngebäude mit seinen Bogengewölben wurden in alter Zeit die Gemeinde- und die Gerichtssitzungen abgehalten.
Über dem gegenüberliegenden, noch bis in die letzte Zeit stehenden Schuppen lag ein Saal, in dem sich einst die Jugend am Tanz vergnügte. Die Schänkberechtigung lag erst auf dem „Kellerhaus“, einem kleinen Gebäude, das sich an der Stelle der heutigen Ratsstube vom „Gasthaus zum Goldenen Stern“ befand. Die Spezialität der Pleißaer Brauerei war ihr sehr gutes einfaches Bier. Dieses wurde in der letzten Brauzeit auch in dem Wohngebäude mit den Bogengewölben geschenkt. Der letzte Lehnrichter ließ die Brandruine bis zu seinem Tode 1931 liegen. Die Erben errichteten schließlich von der Brandkasse das neue Doppelwohnhaus.
Gegenüber diesem Neubau hat die Gemeinde vor einigen Jahren ein neues Spritzenhaus mit Unterkunft für die Sanitätskolonne gebaut.
Seit 1879 ist der „Stern“ im Besitz der Familie Böttger; heute gehört er deren Erben. 1883 wurde der Saal gebaut. Jetzt ist der Stern an den vielfältig geschickten Herrn Rudolf Kaiser verpachtet.
Am „Stern“ steigt ein Weg aufwärts zum Forstgut. Hier befand sich früher eine Oberförsterei, die noch vor 1870 nach Grüna verlegt wurde. In dem Garten des Forsthauses stand bis 1932 ein sehr alter, südländischer Baum mit mächtiger Krone: eine Edelkastanie mit essbaren Früchten. Der strenge Winter 1928/29 hat auch diesen markanten Zeugen alter Zeiten gefällt.
An Scheibe‘s „Gasthaus zum Pleißatal“ und Vockrodts Färberei vorüber gelangen wir bei der Wegbiegung nach Wüstenbrand an das „Gasthaus zum weißen Roß“, das älteste Gasthaus des Ortes, der Sitz der priv. Schützengesellschaft. Dieser Gasthof, der dreimal abbrannte, war früher eine Mahlmühle (noch früher sogar Spinnerei).
Zu ihm gehörte noch ein Gut und eine Bäckerei. Nach dem letzten Brande besaß das „Roß“ selbst eine eigene Lichtanlage.
In der gegenüberliegenden Spindlerbäckerei war früher ein Lokal mit Bierausschank, doch ging auch hier der Schnapsverkauf in ½ Litergläsern besser. Ebenso befand sich in dem Kirsch‘schen Grundstück ein Bierausschank.
An der Straße nach Meinsdorf lag früher oberhalb des Schützteiches in dem etwas zurückliegenden Hause (zweimal abgebrannt) die „Rauhmühle“. Erst später ist ihr dieser Name zuteil geworden, weil der nächste Besitzer, namens Fritz Rauh, eine Tuch-Rauherei darin eingerichtet hatte.
Wo die Straße nach Meinsdorf rechts abbiegt, liegt die „Tannmühle“, ein nettes Restaurant mit Garten, schon zu Meinsdorf gehörend. Die „Tannmühle“ war früher eine Mahlmühle. Sie ist abgebrannt und nicht wieder errichtet worden.
Sehen wir nun die Meinsdorfer Straße wieder zurück bis zum „Roß“ und dann die Hohensteiner Straße nach Limbach zu. Nachdem wir Kirche und Schule hinter uns haben, lädt uns links, von hohen Kastanien überragt, das „Schützenhaus“ zur Rast ein, früher bekannt als Quingers Gasthaus. In den 90er Jahren verkauften Onkel und Tante Quinger, wie sie allgemein genannt wurden, ihr Restaurant.
Der nächste Besitzer, Hermann Weiß, gründete ein Kolonialwarengeschäft (kleine Stube links neben dem Eingang). Der jetzige Inhaber, der unterhaltsame Herr Ernst Steinbach, baute 1929 den Saal an. Das „Schützenhaus“ ist der Sitz der unteren Schützengesellschaft.
Am „Cafe Richter“ vorüber gelangen wir in wenigen Minuten nach Limbach zurück mit dem angenehmen Eindruck, eine an alten Erinnerungen reiche, besonders schöne, etwa einstündige Wanderung durch einen recht sympathischen Ort hinter uns zu haben.“

Originaltext aus 1933
Geschichtliches von Kreuzeiche - Bau der Burgstädter Straße
Geschichtliches von Kreuzeiche - Bau der Burgstädter Straße
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde es in der ausgedehnten Waldgegend von Kreuzeiche lebendiger. Der oben erwähnte lichte Fleck, der zur Flur Mittelfrohna gehörte, wurde besiedelt. 6 Häuser an der alten Burgstädter Straße entstanden in einem Jahr. Es war das Jahr 1852. Die Wirkerei blühte. Dahinten gab’s billiges Bauland. Obendrein an einer Straße, die allem Ermessen noch eine lebendige Zukunft hatte! Dass man einmal rechts „weggesetzt“ liegen sollte und diese Straße nicht als Landstraße ausgebaut würde, wer sollte sowas ahnen? Hätte es der älteste der fünf strammen Söhne des Johann Samuel Römer, der Johann Rinaldini, gewußt, er hätte die unter den Häusern befindliche Schenke mit Kegelschub nicht erst gekauft. Es war diese das Haus mit dem hohen Erker. Die vier anderen Söhne des Johann Samuel Römer, des „Wilden Mannes“, waren die vielen von uns noch gut bekannten, Louis, Schwerin, Moritz und Julius Römer, die alle in hohen Alter gestorben sind, während der älteste, der Vater unseres Tischlermeisters Max Römer, sehr früh , im Jahre 1866, vom Tote ereilt wurde. Ein Jahr darauf sein Vater.
Aber der Bau der neuen Straße erhielt eine Ausführung wie sie die kühnsten Denker und Luftschlösserbauer nicht für möglich gehalten hatten. Der staatliche Straßenbaumeister legte die neue Straße nicht um den Dreibirkenteich (bei Simons Grundstück, Bahnhofstraße, gelegen) herum, um den der alte Weg sich in einen großen Bogen schlängelte, er benutzte weiterhin nicht den Damm des Neuteiches, er scherte sich auch nichts um die Römerische Schenke mit ihren Nachbarhäusern, auch nichts um die Schenke „Zum Wind“ am Fuße des Elzingberges, die ihre Front nach dem alten Weg hatte. (der „Wind“ kehrt der heutigen Straße die Hinterseite zu, die seinerzeit aufs Feld sah), sondern er baute seine Straße zum Staunen aller Zeitgenossen, zu unser aller Freude und zum Segen für den heutigen Verkehr schnurgerade durch den Neuteich und den Elzingteich, während der Dreibirkenteich ganz verschwand.
Kurz entschlossen errichtete Römer im Jahr 1865 an der neuen Straße einen großen Gasthof mit gutsartigen Gehöft, ließ die Schenke an der nunmehr verlassenen Straße „sitzen“ und nahm seine Schankerlaubnis, zu der sich jetzt die Tanzberechtigung gesellte, mit herüber in seinen neuerrichteten Gasthof „Stadt Berlin“. Heute der Gasthof Kreuzeiche. Er diente in den letzten Jahrzenten des vorigen Jahrhunderts, von 1881 bis um die Jahrhundertwende dem Fabrikanten Hermann Brunner auch einmal vorrübergehend zu Fabrikationszwecken.
Bei Beginn des Straßenbaus, 1863, ließ bereits Johann David Lindner aus Limbach die Wirtschaftsgebäude des Gutes „Kreuzeiche“ erstehen, „nachdem er vorher das Grundstück gekauft und urbar gemacht hatte. Vorher war es Waldbestand, welcher bis über den Neuteich nach Limbach herein reichte“. So berichtet Johann August Geisler. Dieser Johann David Lindner war hier Nadelfabrikant, weshalb er heute noch unter den Namen „Nadellindner“ bekannt ist. Er ist derjenige, nach dem der Johannisplatz genannt worden ist, da er zur Erschließung desselben durch Erbauung der Häuser Nr. 1 (Leppert) und Nr. 2 (seinerzeit zweistöckig) wesentlich beigetragen hat.
Originaltext aus Limbacher Heimat-Studien
Eine Sammlung heimatlicher Aufsätze aus dem Limbach Tageblatt 1933
geschrieben von Paul Fritzsching
Michael Nestripke
Förderverein Esche Museum e.V.

Der alte Burgstädter Weg bei Dreibirkenteich und beim Neuteich.
Aquarell von Robert Winkler (1884 bis 1939)
Die Eisenbahn nach Limbach und Oberfrohna
Die Eisenbahn nach Limbach und Oberfrohna
1869
Chemnitz - Leipzig über Burgstädt und an Limbach vorbei
Viel Glück hatte Limbach mit seiner Eisenbahn nicht. Obwohl die Stadt Limbach doppelt so viele Einwohner hatte, die Industrie stärker ausgebildet war, dazu die Strecke über Burgstädt topographisch schwieriger und dadurch natürlich auch teurer war, wurde an Limbach vorbei gebaut und der Strecke über Burgstädt durch die Dresdner Regierung der Vorrang gegeben. Dass die Entscheidung zu Gunsten von Burgstädt fiel, war hauptsächlich der Fürsprache des Burgstädter Abgeordneten Hahn zu verdanken; die Limbacher Landtagsabgeordneten Ernst Esche und Moritz Jungnickel hatten vergeblich versucht, ihren Einfluss geltend zu machen. Wahrscheinlich hatte Limbach doch zu wenig auf Lobby-Arbeit gesetzt, die ja zu Zeiten der Helena Dorothea von Schönberg bestens funktioniert hatte. Für die Limbacher war diese Entscheidung eine totale Niederlage, die Eisenbahn fuhr an Limbach vorbei. Auch aufgrund dieser Entscheidung verlegte der Limbacher Unternehmer Theodor Esche 1870 die Strumpffirma Moritz Samuel Esche nach Chemnitz, er war auf gute Verkehrsanbindung angewiesen. Trotz verschiedener Versuche des Gemeinderates, ihn zum Bleiben zu bewegen, ließ er eine neue Firma in Chemnitz errichten. Für Limbach ein weiterer Misserfolg, schließlich verlor die Stadt damit 500 Arbeitsplätze.
1872
Limbach - Wittgensdorf
Am 8. April wurde die Sackbahn von Wittgensdorf oberer Bahnhof über Hartmannsdorf nach Limbach in Betrieb genommen. Somit konnte wenigstens die Hauptbahn Chemnitz - Leipzig erreicht werden. Limbach gab sich mit dieser Variante zufrieden, und die Bevölkerung feierte an diesem Tag ausgelassen und begeistert. Der Anschluss an die „große Welt“ war, wenn auch mit Umwegen, hergestellt. So ganz glücklich waren aber nicht alle der Anwesenden, und so wurde während des Festessens das Tafellied der „Säckelbahn“ gesungen.
Limbach versuchte, zwischen 1890 und 1895 weitere Verkehrsverbesserungen zu erreichen. So war eine elektrische Bahn nach Waldenburg geplant, die die Anliegergemeinden auch selbst finanzieren wollten. Die Strecke, die über Rußdorf, Falken, Langenchursdorf, Callenberg, Grumbach, Oberwinkel verlaufen sollte, wurde nie gebaut. Allerdings muss man dazu heute feststellen, dass die Dresdener Regierung angesichts verschiedener Petitionen - andere Streckenverläufe waren ebenfalls eingereicht worden - ablehnen musste. In der Dresdner Regierung soll man gesagt haben: „Die sollen sich erst einmal einig werden“.
1897
Limbach Wüstenbrand
Erfolg hatten die Limbacher mit der Anbindung nach Wüstenbrand. Die Strecke verlief von der westlichen Seite des Bahnhofs Limbach über Kändler, Röhrsdorf, Rabenstein, Grüna nach Wüstenbrand. In Rabenstein musste das Tal mit der Burg durch eine große - 23 m hohe und 150 m lange - Stahlbrücke, die auch heute noch existiert, überquert werden. Eine meisterhafte und ästhetisch schöne Ingenieurleistung. Damit war man direkt an die Kohlenbahn, die von Wüstenbrand nach Lugau - Oelsnitz führte, angebunden - ein wichtiger Anschluss in Anbetracht der Kohle fressenden Dampfmaschinen in der heimischen Textilindustrie. Die Strecke wurde am 1. Dezember 1897 eröffnet und am 30. November mit vielen Gästen eingeweiht. Allerdings muss es Schwierigkeiten mit dem Fotografen gegeben haben. Er hatte vor lauter Aufregung seine Apparate in Wüstenbrand stehen lassen. Schade, dadurch fehlen heute Bilder von der Einweihung.
Die Züge fuhren fünfmal am Tag, einige auch bis Hohenstein-Ernstthal. 1950 wurde die Strecke stillgelegt.
1899
Weitere Bemühungen für einen Anschluss nach Leipzig
Mehr als 40 Jahre mussten die vielen Transporte der Oberfrohnaer Industrie mit Pferdefuhrwerken quer durch die Stadt zum und vom Limbacher Bahnhof transportiert werden. In dieser Zeit waren viele Petitionen an die Dresdner Regierung gegangen, die wieder verschiedene Streckenführungen vorschlugen, teilweise auch an Oberfrohna vorbei. Besonders der Kaufmann Rittberger, der in der Karlstraße eine Fabrik besaß, machte sich für die Strecke nach Waldenburg stark, aber auch Oberfrohna, dass die Strecke bis nach Penig über Niederfrohna, Mühlau, Tauscha gebaut haben wollte. Auch da wäre ein Anschluss nach Leipzig möglich gewesen. 1908 wurde diese Strecke vom Landtag in Dresden empfohlen. Die Strecke war tatsächlich so geplant, dass eine Fortführung über Oberfrohna nach Penig möglich gewesen wäre. Besonders der Oberfrohnaer Bürgermeister Willy Böhme war hierbei aktiv und ließ die Planungen nicht ruhen. Er hatte auch das Gelände für den Bahnbau aufkaufen und der Eisenbahnverwaltung kostenlos zur Verfügung stellen müssen.
Endlich wurde die Strecke von Limbach nach Oberfrohna am 30. Juni 1913 mit dem ersten Zug, der 10:45 Uhr mit zwei geschmückten Lokomotiven einfuhr, eingeweiht. Der Viadukt über das Limbachtal war bereits 1912 in Stampfbetonbauweise fertig gestellt worden. An diesem 13. regnete es in Strömen, aber die Bevölkerung war auf den Beinen und freute sich, dass Oberfrohna endlich den Anschluss erhalten hatte. Im Hotel Rautenkranz wurde die Festveranstaltung abgehalten.
Aber auch hier war man natürlich nicht ganz zufrieden, denn die Strecke endete ja erst einmal in Oberfrohna, und man hatte wieder eine „Säckelbahn“. So war der Sieg eben doch nur ein halber Erfolg.
Der Erste Weltkrieg änderte alle Pläne. Es war kein Geld mehr vorhanden, und der aufkommende Kraftwagenverkehr machte die Weiterführung nach Penig überflüssig. Und so blieb die Strecke eine Stumpfbahn, mit allen Nachteilen.
Mit der Wende, als die Textilfabrikation wegbrach, war das Schicksal der Bahn eigentlich schon besiegelt. So wurde erst der Güterverkehr eingestellt. Die Personenzüge, am Schluss mit Dieseltriebwagen betrieben, wurden nicht mehr so stark frequentiert, der Fahrplan wurde ausgedünnt. Die Bahnanlagen wurden nicht mehr gepflegt und damit die Attraktivität der Bahn noch weiter reduziert.
1999
Einstellung des Betriebes
Zum Fahrplanwechsel wurde Oberfrohna abgehängt, der Schienenverkehr in Limbach zum 31. Mai 2000 nach 130 Jahren eingestellt. Die Strecke wurde nicht entwidmet; allerdings sind die Gleise durch den Bau der A72 nach Leipzig unterbrochen. So ist die Große Kreisstadt Limbach-Oberfrohna nun die einzige größere Stadt im Landkreis, die nicht an die Schiene angebunden ist.
Wolfgang Ziemert (t)
Quelle: Dr. Hermann Schnurrbusch: „Streiflichter aus der Heimatgeschichte“ in der Reihe „Unsere Heimatgeschichte“
Der Abdruck erfolgte anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Eisenbahnstrecke Limbach-Wittgensdorf“ mit freundlicher Genehmigung des Fördervereins Esche-Museum. Auf dessen Website finden sich diese und weitere Berichte zur Industrie- und Heimatgeschichte. Eine sehenswerte Ausstellung mit den Schätzen des Verfassers kann im Esche-Museum besichtigt werden.

Kaum wiederzuerkennen: Das Viadukt an der Kellerwiese mit Dampflokbetrieb. Dort, wo damals der Fotograf stand, befindet sich heute das LIMBOmar beziehungsweise dessen Parkplatz. Die heutige Peniger Straße hat den Anschein eines Feldwegs und die Fabrik mit rauchendem Schornstein im Hintergrund ist heute einem Einkaufsmarkt gewichen. (Repro: Stadtarchiv)
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 1. September 2022 -
Zum 340. Geburtstag von Johann Esche, dem Pionier der sächsischen Wirkerei
Das genaue Datum seines Geburtstages ist in keinem Dokument festgehalten. Im 17. Jh. war es den Familien wichtiger, den Tag der Taufe zu beurkunden. Für Johann Esche war das der 03.05.1682. Die Aufnahme eines Neugeborenen in die christliche Gemeinschaft erfolgte damals innerhalb der ersten drei Tage nach der Geburt. Demnach dürfen wir den 1. oder 2. Mai als Geburtstag annehmen und also zu recht jetzt vom 340. Geburtstag Johann Esches sprechen.
Bereits 1703, mit 21 Jahren, ist Johann Esche als erster Strumpfwirker in Limbach nachgewiesen. Sein Wirken und der Nachbau eines seidengängigen Wirkstuhls haben sich jedoch anders zugetragen als es die vielzitierte Legende schildert. Wobei die wahre Geschichte nicht weniger spannend ist. [1]
Schon früh erwarb der Sohn eines Schwarzfärbers in der Färberei seines Vaters Kenntnisse zu textilen Techniken und Erzeugnissen. Zwischen 1701 und 1703 ist außerdem seine Tätigkeit als „Formenstecher“ (Herstellung von Textildruck-Werkzeugen) dokumentiert, bis er dann ab 1703 in den Kirchenbüchern als Strumpfwirker benannt wird.
Er hatte demnach gründliche Kenntnisse über einen Handkulierstuhl, hat offenbar auch an einem solchen wollene Strümpfe gewirkt, als er in Dresden den wohl einzigen damals in Sachsen vorhandenen seidengängigen Wirkstuhl bei einem aus Frankreich stammenden Hersteller von seidenen Strümpfen gesehen hat. Tatsächlich hat er einen solchen Stuhl nachgebaut. Dazu bedurfte es vieler Jahre intensiver Arbeit. Es ging ja nicht nur um den Nachbau eines Wirkstuhls schlechthin, schon das ist kompliziert genug bei einem Gerät, das aus über 2500 ineinander greifenden Teilen besteht. Bei dem Werk, das Johann Esche sich vorgenommen und erfolgreich beendet hat, ging es um einen Wirkstuhl, dessen hohe Teilungsfeinheit, d.h. der Abstand von Nadeln und Platinen zueinander, die Verarbeitung von Fäden in der Feinheit eines Haares ermöglicht.
Bis 1730 wird Johann Esche in den Kirchenbüchern als Strumpfwirker bezeichnet, ebenso wie die außer ihm in Limbach ansässigen Wirker. Um 1727/1731 finden wir die bei ihm zugefügte Berufsbezeichnung Stuhlmacher. Demnach ist ihm der Nachbau eines seidengängigen Wirkstuhls um diese Zeit gelungen, denn ab 1732 wird er in den Kirchenbüchern auch als Seidenwirker bezeichnet. Die Zahl der in Limbach tätigen Wirker betrug damals nur sieben, stieg aber nach 1732 dank der zielgerichteten Förderung des Rittergutsbesitzers Antonius III. rasch an.
Der frühe Versuch einer Innungsgründung (1737/1739) scheiterte zwar, die Zusammenarbeit der Wirker, Verbesserungen des Wirkstuhls sowie die Erschließung von Handelswegen fand unter der „Direction“ des Johann Esche statt. Er legte als erster Strumpfwirker, Wirkstuhlbauer, Handelsmann im Strumpfvertrieb und Fabrikant (Hersteller in Meisterbetriebs-Größe) den Grundstein für das Limbacher Wirkereigewerbe und war Stammvater einer engagierten und darum erfolgreichen Wirker- und Kaufmannsdynastie.
Irmgard Eberth, Förderverein Esche-Museum e.V.
[1] Die hier dargelegten Fakten folgen den Ausarbeitungen von Dietrich Esche, Jürgen Lohr + u.a. , Die Esche-Wirker publiziert in www.förderverein-esche-museum.de

Foto: D. Träupmann
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 12. Mai 2022 -
Das Kriegsende in Bräunsdorf
Nachdem das 1000-jährige Reich bereits nach zwölf Jahren seinem Ende entgegen ging, wurde auch Bräunsdorf in diese Schlussphase mit einbezogen. Im Großen und Ganzen blieb der Ort von kriegerischen Handlungen verschont. Allerdings wurden auch alle wehrfähigen Männer eingezogen, von denen 116 nicht wieder kommen konnten und in der Fremde ihr Grab finden mussten. Für diese gefallenen Bräunsdorfer haben wir auf dem Friedhof einen Gedenkstein neben den Gedenksteinen der gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges errichten lassen. Nach dem der Zweiten Weltkrieg ausbrach, kamen auch Kriegsgefangene nach Bräunsdorf und mussten hier arbeiten. In der Regel wurden die Gefangenen im Ort fair behandelt, so dass z.B. französische Kriegsgefangene auch nach dem Krieg noch Kontakte zu Bräunsdorfern unterhielten. Ich habe mich in meiner Amtszeit mit mehreren Bürgern über die Ereignisse zum Kriegsende in Bräunsdorf ausgetauscht und kann hier einige Geschehnisse wiedergeben. Interessant war die Tatsache, dass die Amerikaner über keine exakten Landkarten verfügten, denn unser Bräunsdorf war da gar nicht aufgeführt. So kam es, dass die Amerikaner von Waldenburg und über Wolkenburg-Kaufungen nach Limbach vordrangen und Bräunsdorf in der Mitte verfehlten. Aber sie kamen dann doch noch in unseren Ort und die Kinder staunten, als sie erstmalig farbige Soldaten erblickten und sogar Schokolade bekamen. So freundlich waren einige Tiefflieger nicht, welche auch über unseren Ort flogen und auf alles schossen, was sich bewegte. Man fragt sich, was sich wohl in den Köpfen der Piloten abspielte, welche auf wehrlose Zivilisten und Kinder zielten. Bräunsdorf gehörte dann bis zum Sommer zur Kommandantur in Waldenburg. In Limbach gab es auch eine Kommandantur und die Soldaten kamen ebenfalls nach Bräunsdorf und wollten Frischewaren von den Landwirten. Allerdings hatten die Amerikaner festgelegt, dass die Soldaten nur in dem jeweiligen Kommandantur-Bereich Waren eintreiben konnten, so dass sie in Bräunsdorf leer ausgingen. Ein Glücksumstand war auch, dass die Geschützstellung im Gemeinedewald keine geeignete Munition hatte und demzufolge keinen Schuss abgeben konnte, denn dann hätten die Amerikaner kräftig gegengehalten und unser Oberdorf sicherlich in Schutt und Asche gelegt. Insgesamt waren unsere Bürger froh, dass nun der furchtbare Krieg zu Ende war und man seinem schwierigen Tagewerk nachgehen konnte.
Hartmut Reinsberg, Ortsvorsteher a.D.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 14. April 2022 -
Georg Baumgarten der fliegende Oberförster
Am 21. Januar hätte Georg Baumgarten seinen 185. Geburtstag gefeiert. Auf Anregung des Stadtarchivs hat die „Stadtspiegel“-Redaktion den ausgesprochenen Luftschiff-Kenner Hartmut Reinsberg um einen Artikel zu diesem außergewöhnlichen Menschen gebeten. Vielen Dank dafür.
Georg Baumgarten der fliegende Oberförster
Die meisten Bürger gehen ja davon aus, dass die Luftschifffahrt vom bekannten Graf Zeppelin begründet wurde. Allerdings hatte der am 21. Januar 1837 in Johanngeorgenstadt geborene Georg Baumgarten bereits ab 1873 mehrere Luftschiffmodelle gebaut welche eine Flughöhe von zwei Meter erreichten. Er experimentierte weiter und bis 1882 erfolgten insgesamt zwölf Patentanmeldungen über das lenkbare Flügelluftschiff. 1879 erfolgte der Aufstieg des ersten bemannten Luftschiffes mit dem Beweis des Antriebes und der Lenkbarkeit. Er hatte damals mehrere Unterstützer aus der Region, welche Baumgarten umfangreich finanziell unterstützten. Baumgarten bekam damals Probleme mit seiner vorgesetzten Forstbehörde und musste seinen Wohnsitz im Forsthaus Pleißa verlassen und verzog in eine neue Dienstwohnung nach Grüna. Da er aber von seiner Forschung am Bau von Luftschiffen nicht abließ wurde er seines Amtes als Oberförster enthoben und musste seine Dienstwohnung verlassen. Er zog nun mit seiner Familie mit acht Kindern nach Siegmar und arbeitet weiter an seinen Luftschiffprojekten, welche technisch auch mit Unterstützung vom vermögenden Leipziger Buchhändler Dr. Friedrich Herrmann Wölfert weiterentwickelt wurden. Es erfolgten weitere erfolgreiche Luftschiffaufstiege. 1882 erfolgte ein Luftschiffaufstieg in Berlin vor Mitgliedern des Kriegsministeriums und des Generalstabes, wo auch Graf Ferdinand von Zeppelin unter den Zuschauern gewesen sein soll. Leider verdrängte Dr. Wölfert immer mehr Baumgarten an der weiteren Vermarktung des von Baumgarten patentrechtlich geschützten lenkbaren Luftschiffprojektes und es kam es kam zwischen den beiden zum Zerwürfnis.1883 erkrankte Baumgarten und kam nach mehreren Krankenhausaufenthalten in die Landes-Irrenanstalt nach Colditz, wo er im Alter von nur 47 Jahren am 23. Juni 1884 an Tuberkulose verstarb. In Pleißa hat der frühere Ortsvorsteher Michael Nessmann am ehemaligen Wohnhaus von Baumgarten eine Gedenkstelle mit Bank einrichten lassen und die frühere Gemeinde Grüna hat eine Straße nach dem berühmten Sohn benannt. Nach der Wende wurde im Folklorehof Grüna eine Ausstellung über das Wirken von Baumgarten eingerichtet, welche dann nach einer überarbeiteten Konzeption vom Heimatverein Grüna 2019 in das Erdgeschoß des ehemaligen Rathauses von Grüna überführt wurde.
Hartmut Reinsberg
(Foto: Wikipedia)
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 3. Februar 2022 -
Das Försterhäuschen
Das Försterhäuschen
Dank des Unternehmungsgeistes von Johann Esche (*1682, †1752), seiner Familie und seiner Gutsherrn Antonius II. (1674-1702) und Antonius III. von Schönberg (1703-1745) florierte in der Mitte des 18. Jahrhunderts die Wirkerei in Limbach. Die Einwohnerzahl nahm deutlich zu, Limbach wurde zum ersten Strumpfwirkerort in Sachsen. Mit der steigenden Einwohnerzahl wuchs der Mangel an Wohnungen. Deshalb ließ George Anton von Schönberg (1746-1755) Teile von Feldern zweier zum Rittergut zugekauften Bauerngüter (Anke und Baldauf) zur Besiedlung freigeben. Diese Vorhaben für die erste planmäßig angelegte Strumpfwirkersiedlung Sachsens erforderten große Mengen an Baumaterial – Steine, Kalk, Sand, Bauholz, gebrannte und ungebrannte Ziegel – und führten dazu, dass die Gutsherrschaft schon 1747 eine Ziegelei anlegen ließ. Der Grundherr starb 1755 und seine Witwe Helena Dorothea von Schönberg führte das Vorhaben weiter. Mit der Bebauung des Helenenberges war schon 1750 begonnen worden, mit der des Dorotheenberges erst später. Dazu wurden Parzellen vom Grundbesitz des Rittergutes in Erbpacht vergeben. Der Helenenberg wurde in 68 Baustellen zu 1.384 m² (½ Scheffel Dresdner Maß) vergeben, die unteren 34 waren bereits 1785 bebaut, die obere Hälfte später. Auf dem Dorotheenberg wurden 18 Baustellen von je 1 Scheffel Landes (2.767 m²) vermessen und bis um 1790 bebaut. Diese beiden neuen Ortsteile – abgelegen vom eigentlichen Dorf Limbach – wurden noch über Jahrzehnte als besondere Dörfer benannt.
Der Rittergutsverwalter Ludwig Dietrich Frantz schrieb an seinen Gutsherrn George Anton von Schönberg am 26. September 1747, der Ziegelofen sei ausgegraben und am 12. Oktober 1747, die Ziegelscheune sei bald fertig. „Ziegelscheune“ meint die ganze Ziegeleianlage einschließlich Wohnhaus des Ziegelmeisters – das spätere „Försterhäus-chen“. Der Ziegelofen glich einem kurzen Bergstollen. Er wurde „ausgegraben“ und war 10½ Ellen (6,30 m) lang, 3½ Ellen (2 m) hoch und 3 Ellen 1,80 m) weit, die Elle zu 0,60 m gerechnet. Eine umfangreiche, tiefe Lehmgrube reicht von Häusel bis an den Schützenhausweg (etwa Pestalozzistraße) und bis an die Peniger Straße. Der spätere Eigentümer der Grube, Baumeister Sussig, hat sie um 1900 zugeschüttet. Diese Ziegelei war 100 Jahre in Betrieb, 1747 bis 1847, danach machten große Ziegeleien mit leistungsfähigeren Ringöfen (z.B. Ziegelei Siegel) die kleinen Anlagen überflüssig und die „Ziegelscheune“ diente dem Rittergutsförster Schulze, dann dem Förster Micklisch als Wohnung. Aus dieser Zeit stammt die Bezeichnung „Försterhäusel“. Später diente das Haus noch als Wohnung für Rittergutsbedienstete, nach 1883 waren die Besitzer der Baumeister Ludewig-Sussig und später der Klempnermeister Weber, Querstraße 6. 1834 hatte die Limbacher Schützengesellschaft in der Nähe ein Schießhaus erworben. Nachdem die Ziegelei ihren Betrieb eingestellt hatte, diente der Ziegelofen als Keller und erregte noch bei der Neubebauung des Grundstücks mit einem Einfamilienhaus Verwunderung als rätselhafte, überdimensionale Katakombe. Der Ursprung war wohl vergessen.
Rudolf Weber berichtet in seiner Chronik von Limbach-Oberfrohna am 21. Juni 1968:
„Das Försterhäuschen zuletzt im Besitz von Frau Weber, Querstraße 6 (Porzellan-Weber), wird wegen Baufälligkeit abgebrochen. Es ging aus dem Besitz von Frau Weber durch Vererbung an einen Herrn Thomas, wohnhaft in Döbeln, über.“
Die kleine Verbindungsstraße zwischen der Peniger und der Pestalozzistraße heißt heute noch „Am Försterhäuschen“ und erinnert daran, dass dort vor über 150 Jahren der Rittergutsförster wohnte im früheren Haus des Ziegelmeisters der Rittergutsziegelei von 1747.
Dr. Hermann Schnurrbusch
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 6. Januar 2022 -
Die Königliche Sächsischen Meilensteine in Limbach-Oberfrohna
Ab 1859 bis 1866 begann man im Königreich Sachsen Meilensteine aufzustellen. Eigentümer der Meilensteine sind in Sachsen die jeweiligen Straßenbaulastträger der Wege und Straßen, an denen diese Steine stehen.
Nach 1840 erfolgte die Umstellung in Sachsen auf eine neue Länge der Meile, nämlich von 7,5 km. 1858 begannen auf Anordnung des sächsischen Finanzministeriums die Neuvermessung der Straßen und das Aufstellen neuer Entfernungssteine. Meilensteine und Halbmeilensteine wurden im Verlauf der Straße im dadurch gekennzeichneten Abstand aufgestellt. Beim Abzweig einer Nebenstraße, auf der eine Postroute verlief, von einer Hauptstraße wurde ein Abzweigstein aufgestellt.
Charakteristisch sind die je nach Art unterschiedliche Eisengusskronen an diesen Meilensteinen. 1875 führte man das metrische System im Deutschen Reich ein. Damit waren die Meilensteine Geschichte. Mit der Umstellung auf das metrische System, wurden die Meilensteine oft umgestaltet. In Sachsen stehen die Königlich-sächsischen Meilensteine als Sachgesamtheit unter Denkmalschutz, was auch originalgetreue Nachbildungen und Reststücke dieser Technischen Denkmale einschließt.
Michael Nestripke
Förderverein Esche Museum
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 30. September 2021 -
Stolze Geschichte der Arbeiterschaft
Von den Anfängen unserer 150 jährigen sozialdemokratischen Vereinsarbeit im Limbacher Land
Bild 1
Frühe Bestrebungen
Mit ihrer Wirtschaftsförderung schuf Helena Dorothea von Schönberg (1729 - 1799) entscheidende Vorraussetzungen für die Entwicklung unserer Stadt hin zu einem bedeutenden Standort der frühen Textilindustrie. Kaum 30 Jahre später wurden aus der Handwerkerschaft bereits erste arbeitsrechtliche Forderungen laut: ,,Am Abend des 18. September (1830), einem Samstag, erhielt Gerichtsdirektor Christian Friedrich Schink durch den Gerichtsschöppen Künzel die Nachricht, dass im hiesigen Gasthof unruhige Bewegungen entstanden seien, die den herkömmlichen herrschaftlichen Stuhlzins zum Gegenstand hätten. Der größte teil der anwesenden Strumpfwirker bestehe auf einer gänlichen Abschaffung des Stuhlzinses", Aufhebung zu leistender Frontage und Abgaben für die Spinnerei. 2) Ein Gesuch Limbacher Strumpfwirker auf Erlass des Stuhlzinses wurde vom Sächsischen König bereits zwei Jahre zuvor abgelehnt. Fabrikdörfer rund um Chemnitz seien ,,beinahe durch und durch republicanisiert."3)
Als frühe Demokratiebewegung organisierten sich Vaterlandsvereine. Im Jahr 1848 zählte bereits allein deren Limbacher Ortsgruppen 250 Mitglieder.4)
Recht haben und Recht bekommen - das allgemeine, gleiche und direkte Männerwahlrecht
Nach der Wahl zum 1. Deutschen Reichstag im Jahr 1871 berichtete der Volksstaat aus Leipzig von ,,Wahlumtrieben" in Limbach, die den sozialdemokratischen Kandidaten Spier klar benachteiligten:
Bild 2
Limbach, 20. März, Einige W a h l u m t r i e b e nachträglich: In Mittelfrohna hat der Rittergutsbesitzer v. Wiluki jun. im Wahllokal, am Wahltisch, seinen Arbeitern gedruckte Stimmzettel für Dr. Biedermann gegeben. Namhaft zu machen ist hierfür Gottlob Heitmann, Pastor. Dabei hat besagter Wiluki jedem ein T r ö p f c h e n B i e r verabreicht. In Oberfrohna und Kändler sind nicht, wie bei der ersten Wahl, unbeschriebene Zettel ausgereicht worden, sondern blos gedruckte für Dr. Biedermann, in Kändler sogar durch den Gemeindediener. In Wüstenbrand hat man nach der Mittagsstunde, nachdem es den Anschein hatte, daß viele Stimmen für Spier eingingen, die Wähler des Herrn Biedermann durch die Polizei holen lassen!
(Der Volksstaat, Leipzig v. 19.04.1871)
Die Sozialdemokratische Bewegung im Limbacher Land
Am 24. Mai 1863 gründete sich in Leipzig der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV), direkt von hier aus wurde der Grundstock zu einer Sozialdemokratischen Bewegung in Limbach gelegt.5) So kann davon ausgegangen werden, dass bereits 1863/64 hier vor Ort ein ADAV-Ortsverein bestand. Im Jahr 1869 berichtete das Limbacher Tageblatt über hiesige, gut besuchte Arbeiterversammlungen in nahezu 14 tägigen Rhythmus.
Als August Bebel mit seinem Arbeiter Commité an Einfluss gewann, zeichnete sich ein genereller Richtungsstreit zwischen dem ADAV und der in Eisenach neu gegründeten sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) ab. Letzlich überzeugte der ,,Arbeiterkaiser" August Bebel die Limbacher Arbeiterschaft und im hiesigen Wochenblatt war die Ankündigung einer öffentlichen Versammlung zu lesen, Tagesordnung: ,,Die Organisation, Grundsätze und Bestrebungen der Deutschen Arbeiterpartei." Horst Strohbach datierte die Gründung des Limbacher Ortsvereins der SDAP auf den 9. September 1871, vor nunmehr 150 Jahren.
Das große Arbeiterfest - Man verstand zu feiern
Bereits im zweiten Jahr seines Bestehens richtete der Ortsverein zur Sächsischen Landtagswahl 1873 ein großes Arbeiterfest aus. ,,Es wurden Parteigenossen, sowie alle Arbeiter von Nah und Fern zu recht zahlreicher Betheiligung eingeladen."
Bild 3
Limbach. Am 29. Juni hielten wir hier ein allgemeines Arbeiterfest ab, welches, vom herrlichen Wetter begünstigt, so manchem Widersacher bewiesen hat, daß der Arbeiter es versteht, sich auf derartigen Festen zu bewegen. Schon vom frühen Morgen an fanden sich schaarenweise die fremden Gäste ein. Der Mittag brachte uns gegen 400 Chemnitzer Parteigenossen, an welche sich die Rabensteiner angeschlossen hatten. In Burgstädt hatten sich anderen benachbarten Orte angeschlossen; den tiefsten Eindruck aber machte es, als der lange Zug Hohenstein- Ernstthaler, an dem sich Lunzenauer und andere Orte angeschlossen hatten, sich dem Festplatze näherte. Dieser Zug mag manchen der Ausbeuter, welche zugegen waren, mit Wuth erfüllt haben. Die Festrede Vahlteich´s hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Im Uebrigen verlief das Fest , trotz des großen Andranges, in schönster Harmonie. Dieses Fest hat für die nächsten Reichstagswahlen tüchtig vorgearbeitet, und wenn Muth und Ausdauer nicht verschwinden, dann wird der 15. Wahlkreis einen glänzenden Wahlsieg zu verzeichnen haben.
Mit sozialdemokratischem Gruß:
H. Kühn, Vorsitzender des Festcomité´s
(H. Kühn, Der Volksstaat, Leipzig v. 11.07.1873)
Sozialdemokratischer Blick auf die Vorbereitungen zur Stadtrechtsverleihung Limbachs
Sich nicht abfinden wollend mit derart gravierender sozialer Ungerechtigkeit, schrieb H...n. einen gepfefferten Artikel für den Leipziger Sozialdemokrat:
Bild 4
L i m b a ch, im November. Die Spitzen der hiesigen Gemeinde sind in freudiger Erregung, denn – Limbach wird zu Neujahr mit „allerhöchster“ Genehmigung S t a d t. Daher gab´s seit einigen Wochen nichts als bengalisches Feuer mit Lamentation – pardon I l l u m i n a t i o n. Uns kann´s Nichts schaden, wir gewinnen nur; unsere Gegner liefern uns dadurch nothgedrungen Waffen in die Hände, die wir gehörig ausnützen werden. Hat da der Gemeinderat beschlossen, dem Gemeindevorstand Jungnickel (der nicht Jura studiert, folglich nicht Bürgermeister werden kann) lebenslänglich die Hälfte seines bisherigen Gehalts, nämlich 1500 Mark jährlich, zu bewilligen, wenn – man höre! – wenn er in Limbach bleibt. Welche theure Reliquie, welch theures Andenken einer früheren Dorfgemeinde! Wenn ein Arbeiter 18 Jahre oder noch länger bei einem Fabrikpascha gedient hat, so bekommt er nicht nur keinen Ruhegehalt, sondern man schränkt ihn – nicht ein, sondern a u s. Ein solcher Beschluß, wie obiger, weckt das Rechtsgefühl vieler Indifferenten, denn hier handelt sich´s um´s liebe Geld, und in Geldsachen hört bei sonst gemüthlichen Leuten die Gemüthlichkeit auf H . . n.
(Sozialdemokrat, Leipzig v. 07.12.1882)
Hätten Sie's gewusst?
Soweit ein kleiner Eindruck, aus der ersten Dekade unserer wechselvollen Ortsvereinsgeschichte.
Mehr dazu und wie es weiterging, findet sich in unserer Jubiläums-Chronik unter www.losozis.de/Geschichte
Iris Raether-Lordiek
Quellen:
1) Foto Privatbesitz
2) Michael Hammer, Volksbewegung und Obrigkeiten. Revolution in Sachsen 1830/31, Weimar u. a. 1997, S. 184
3) Hauptstaatsarchiv Dresden 10736: Ministerium des Innern Nr. 11033, Bl. 147
4) Vaterlandsblätter Beilage zu Nr. 167, 30. 9. 1848, S. 2ff
5) Ernst Heilmann, Geschichte der Arbeiterbewegung in Chemnitz und dem Erzgebirge, Chemnitz 1912, S. 24
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 24. Juni 2021 -
Etwas mehr zur früheren Wasser- und Wasserkraftnutzung am Standort des neuen Verkehrs- und Kreativgartens Oberfrohna
Herr Dr. Schnurrbusch erläuterte bereits im Stadtspiegel viel zur Geschichte des Spielplatzes. Das kann durch einige weitere Angaben mit Blick auf die heute selbst langjährigen Oberfrohnaern nicht mehr dort vorstellbare Wassererkraftnutzung ergänzt werden.
Nicht lange nach Beginn des Spielplatzbaues legten die Bauleute eine aus hiesigem Naturstein, dem Granulit, aufgesetzte längliche Grube frei. Sie befand sich im östlichen Teil schräg von der Straße des Friedens her. Darin sah man unten Richtung Frohnbachstraße eine gewölbte Öffnung, ebenfalls aus solchen Steinplatten. Ein Blick hinein ergab, dass sich noch ein überdecktes Ziegelgewölbe anschloss. In dem Bereich verläuft der Bach abgedeckt neben der Straße. Ohne Zweifel kann die Grube nur die Radstube der ehemaligen Obermühle in Oberfrohna gewesen sein. In einem durch Horst Strohbach nachgezeichneten Ortsplan von vor 1820 sind an der Stelle die Mühlengebäude zu erkennen.
Das trocken gesetzte, kaum nachgehauene Natursteinmauerwerk dieser aufgefundenen Radstube ist gegenüber dem von anderen, wie das der Wetzelmühle, vom Bearbeitungsaufwand her sehr einfach hergestellt worden. Sie dürfte daher bereits aus der Besiedlungszeit stammen. Eigentlich bedeutet das, man ist auf das älteste noch vorhanden gewesene Bauwerk von Oberfrohna gestoßen.
Fast immer gibt die Urkundenlage vor der Reformation hauptsächlich herrschaftliches Handeln, Erbe, Käufe-Verkäufe oder Streitigkeiten her. Dörfliches Leben in den ersten dreihundert Jahren der Besiedlung unserer Gegend darf man anhand geschichtlicher Beschreibungen aus anderen Gegenden sicher hier ähnlich annehmen. Kundiges Zusammenführen von Beobachtungen in hiesiger Landschaft wie Flur- und Lage älterer Gebäude sowie Wege kann das ergänzen. Und praktisches Handeln sollte man den Altvorderen immer zutrauen. Stets war es Grundlage für technischen Fortschritt. Das galt auch für das Mühlenwesen.
Wasserräder als Maschinenantrieb verwendete man bereits seit mehr als 2000 Jahren vom Mittelmeerraum bis nach China. Mechanisches Wissen zur Wasserkraftpraxis ging trotz aller Kulturverluste nach der Römerzeit nicht verloren. Wasserkraftnutzung galt seit Jahrhunderten als Regal der Landesherrschaft. Das heißt, über die Zuteilung des Standortes entschied diese. Jährlich war dafür ein Wasserzins zu zahlen. Solcher Verwaltungsakt erforderte gewisse zentrale Lagekenntnis in Verbindung mit Wahrnehmen von Wasserflüssen. Als Rechtsziel galt bereits im Hochmittelalter:
Kein Wassertriebwerk sollte dem anderen das benötigte Wasser abgraben.
Aus schon lange zuvor üblichen Rechtsgebrauch festigte 1158 als kaiserliches Regal Friedrich I. (Barbarossa) den Mühlenbann oder -zwang. Das gestattete grundsätzlich der Gemeindeherrschaft den Bau einer Mühle. Ausschließlich in dieser mussten die zugehörigen Bauern im Ort sowie der Umgebung ihr Getreide mahlen lassen. Sie zahlten in Naturprodukten, die Metze. Verpachtung war zugelassen. Aus der Verordnung kann man auf die Bedeutung von Mühlen in den Gemeinwesen bereits damals schließen. Soweit ist es auch begründet anzunehmen, dass es eine solche in Oberfrohna schon vor der dem Ort zugerechneten Ersterwähnung Vrono et Lympach 1356, also etwa 150 Jahre nach der Besiedlung gab,
Die allgemeine Sicherheitslage einer Ansiedlung der Landkolonisierung im Osten war bis zu den Hussiteneinfällen und dem sächsischen Bruderkrieg Mitte des 15. Jahrhunderts ziemlich instabil. Daher positionierte man eine derartig wichtige Einrichtung wie die Mühle nahe dem meist noch wehrhaft umfriedeten Ort. Geringaufwändige Transportwege bei damals verfügbaren Zugtieren wie Pferd und Rind waren ein weiterer Faktor in der Abwägung dazu. (Chronik Pfarrer Päßler S.18 . Müllerei eingangs des Ortes)
Nebenbei: Zum einen bedeutet das, die Güter weiter ober- oder unterhalb in Oberfrohna kamen erst später als Siedlungszuwachs hinzu. Notwendiges Roden der umgebenden Wälder von Hand war sowieso ein gewaltiger Kraftakt. Nach und nach erfolgte es vom Ort bzw. der Hofstätte weg. Auch blieben abgelegene Flächen in Herrschafts- oder Kommunbesitz. Erst später kauften wirtschaftlich gut stehende Bauern die zu oder erhielten Aussiedler bei Hofneugründung.
Ortsgeschichtlich interessiert könnte man noch fragen: Wo stand ursprünglich das Gehöft des örtlichen Anführers der Siedlergemeinschaft, dem Kolonisator? Von der Mühle aus gesehen wäre die leicht erhöhte Lage des jetzigen Schulgartens geeignet. Dort befand sich vor seinem Abriss 1937 das Herrmann Fischer'sche Gut. Umfangreiche Wirtschaftsflächen beidseitig der Rußdorfer Straße gehörten dazu. Vom Hang gegenüber gingen sie bis in den Gemeindewald zur Flur Bräunsdorf. Deutlich wahrnehmbar ist noch dort ein sogenannter Landgraben mit Wall nach auswärts.
Die Obermühle war 1670, also nach dem Dreißigjährigen Krieg mit massiven Bevölkerungsrückgang und Zerstörungen, dazu der Pest, als Mahl- Öl- und Schneidemühle bezeichnet worden. Sie besaß der Quelle nach nur einen Mahlgang. Die anderen Gewerke dürften bereits im 16. Jahrhundert, vielleicht sogar nicht lange nach ihrer Errichtung dazu gekommen sein. Man brauchte schon jeher nicht nur Mehl, sondern genauso Öl und auch Bretter. Nebenbei kann das noch als Hinweis auf Gewerbe und Handel sowie einfachen Maschinenbau in Oberfrohna zu sehen sein. Das Ausmaß der aufgefundenen Radstube ermöglichte einen Wasserraddurchmesser bis etwa 4,5 m (ungefähr 6 bis 7 Ellen) bei einer Breite von etwa 0,9 m (ca. 1 1/2 Ellen). Je nach Auftreffen des Zulaufs, d.i. Aufschlag, haben sich die Begriffe oberschlächtig, mittelschlächtig und unterschlächtig eingebürgert.
Die Wasserkraft eines Rades beruht auf dem Füllen der im äußeren Umfang eingebauten Kammern (Zellen). Die bewegen sich durch die dabei sich aufbauende Schwerkraft hinunter. Wirksam wird nur ein Teil vom Radumfang. Unterhalb der Radachse fällt das Wasser wieder heraus. Günstig ist also zum einen ein grösserer Raddurchmesser. Zum anderen: Je mehr die Kammern fassen und sich aufgrund von viel Zulauf schnell füllen können, um so kraftvoller ist die Wirkung. Abhängig war die jeweilige technische Lösung also von verfügbarer Wassermenge in Verbindung mit dem Gefälle des Fliessgewässers. Im Fazit bot ein oberschlächtiges Wasserrad gegenüber mittelschlächtigen die beste Energieeffizienz. Entsprechende Erkenntnisse lagen bereits früh vor. Hier im Berg- und Hügelland mit kurzstreckigen Höhenunter-schieden konnte bei nicht zu langer Heranführung ohne weiteres der Zulauf von oben auf das Rad eingerichtet werden. Wesentlich mehr Wasser lief im Frohnbach nach den weiter unten einmündenden Limbach und Pfarrbach, das Einzugsgebiet vor und in Oberfrohna brachte naturgemäß weniger. Daraus kann man sicher noch auf die gegenüber Nieder- und Mittelfrohna spätere Ansiedlung hier schließen.
Bei damaliger Geländebewertung kamen die Altvorderen auf eine Stelle zur Wasserentnahme leicht oberhalb der späteren Bergstraße. Aus zuerst nur einen einfachen hölzernen Stau wurde dann im Laufe der Zeit ein in Stein gesetztes Wehr mit Tiefablass. Der Graben zur Obermühle verlief von dort zunächst zwischen Bach und der jetzigen Frohnbachstraße. Die war ehemals wie in den Ortschaften üblich, nur ein das Fließgewässer begleitender Erschließungsweg. Ihr Knick ab der Reinholdstraße talwärts beruht mit auf der geradlinigen Grabenführung weiter in den heutigen Promenadenweg. Klassisch ist zum Höhengewinn anschließender Verlauf entlang am etwas steileren Hang des Bachtales. Der irgendwann später entstandene Weg hinauf zur Anhöhe war dann mit einer Überquerung auszustatten. Ältere im Ort kennen ihn noch als Schulberg, zuvor eben der Mühlberg, jetzt die endende Straße des Friedens. Als günstig für eine Mühle war ein Standort kurz danach erkannt worden. Der nun wieder hier nahe, aber tiefere Frohnbach bot dem ablaufenden Wasser einen kurzen Weg zurück. Offen bleibt, ob sich die zwischen Zu- und Ablauf gewählte Höhendifferenz nach dem vorgesehenen Raddurchmesser orientierte oder umgekehrt, dieser sich nach der daraus machbaren richtete. Obergräben legte man sowieso mit geringst-möglichem Gefälle an. Hier war er nur etwa 310 m lang, also mit nicht sonderlich hohem Aufwand anzulegen gewesen. An der Bachentnahme und vor dem Wasserrad gab es jeweils einen Rechen für Treibgut bzw. als Eisfang. Weiter gehörten unmittelbar an der Anlage eine Absperrmöglichkeit, ein sog. hölzernes Schütz sowie ein Notabschlag als Umlauf vor dem Wasserrad dazu. Anfangs dürfte das letzte Grabenstück vom Hang bis auf das Rad nur ein Holzgerinne auf Stützen gewesen sein. Technischen Fortschritt gab es natürlich und vor allem im 18. Jahrhundert beim Mühlenbau. Das bedeutet, dann Ausbau als in Stein gemauerter Hochkanal. Auch winterlichen Frost galt es zu berücksichtigen. Wegen der notwendigen Wasserdichtheit war dabei solide Arbeit erforderlich.
Erkenntnisse zum verfügbaren Zufluss aus einem vorliegenden Einzugsgebiet erfordern natürlich Beobachtungen über mindest ein Jahr. Der im Frohnbach ist also bereits zur Besiedlungszeit als ausreichend für eine Wassermühle eingeschätzt worden. Zulauf muss entweder als fließende Welle dauerhaft anliegen oder zumindest um einen Mühlenbetrieb während üblicher Arbeitszeiten absichern zu können. Im Harzer Bergbau führte man nach 1715 als Mengenzuordnung das Maß ein Rad Wasser ein. Das waren 37,85 Liter pro Sekunde (l/s). Zwar nicht so viel aber mindestens die Hälfte wird der hier überlieferte eingängige Mahlbetrieb erfordert haben. Kam das an? Aus dem Einzugsgebiet des Frohnbachs oberhalb von Oberfrohna liefen zwischen 1965 und 1990 oberhalb der „Aktie“, nachher Wünschmannsche Färberei, im Jahresschnitt etwa 8 bis 10 l/s in das Gemeindegebiet. Niederschlag und Schmelzwasser kamen aber bereits vor Jahrhunderten meist nur bis ins späte Frühjahr reichlich im Fließgewässer an. Danach gingen die Abläufe bis zum Wintereinbruch fast immer zurück. Man brauchte jedoch während der Betriebszeiten der Mühle in Oberfrohna mehr oder konnte nur zulaufabhängig arbeiten. Etwas besser ging es mit vorgelegenen Schutz- (Schütz-) teichen. Solche nutzten die Müller praktischerweise durch Aufsammeln von Wasser, denn nachts, sonn- und feiertags war, teils aus religiösen Hintergrund, Betriebsruhe. Mehrere Mühlen schlossen sich manchmal noch zu Wassergenossenschaften zusammen:
H. Strohbach, Geschichte und Überlieferung des Bauerntums zu Oberfrohna:
Die alte Obermühle, vorm. Handschuhfabrik H. Rätzer: Aber weiteres erzählte mir erst Herr Bäcker i. R. Gräfe, der noch lebende Sohn des einstigen Obermüllers...:
Der große Teich gehörte zum Gasthof Rautenkranz, dessen Besitzer mein Onkel war. (1864 Gemeindedokument). ...und weil die Mühle ebenfalls im Besitze des Gastwirt war, hatte er das Recht, das Wasser für seine Zwecke zu verwenden, besonders für Mühlenzwecke. Er leitete das Wasser vom großen Teich durch den Frohnbach, bei Rebskes Färberei ab, die Promenade entlang nach der Mühle, in den Schutzteich. Die gesamten Mühlen des Frohnbachtales: also die Obermühle selbst, die Käfersteinmühle, die Nickelmühle, in Mittelfrohna die Hofmühle, die sogenannte Dörfelmühle, jetzt (1932) die Schneidermühle, die Wetzelmühle, die Niederfrohnaer oder Krittnermühle und schließlich die Holzmühle zahlten dem Obermüller 2 1/2 Taler und erhielten bei Wasserknappheit des Frohnbachs das Wasser aus dem großen Teich oder Schutzteich dafür geliefert. Es wurden „eben dann 1 oder 2 Bretteln gezogen, daß genügend Wasser in die Mühlenbetriebe gelangen konnt“
Dieser große Teich ist der neben dem heutigen Stadtpark auf ehemaliger Flur Rußdorf, vor 1920 aber noch kleiner. Nach Fischmeister Heinz Schimmel benutzte den Begriff Wehrteich für ihn bereits sein Vater Walter.
Im Ausbau der Wünschmannschen Färberei dann war auch die Wassergewinnung einbezogen. Den Frohnbach neben dem Werk erweiterte man zum unteren und oberen Kanal. Dazu wurde das Speichervolumen der drei Teiche darüber erhöht.
Nebenbei: Nach dem I. Weltkrieg legte Walter Schimmel zu den schon vorhandenen beiden Nötzoldschen Teichen nach und nach bis 1939 die zunächst anderen 10 der nach ihm benannten Fischzuchtanlage im Frohnbachtal weiter oben an.
Dagegen existierte der heutige Große Teich bereits seit oder sogar vor dem 16. Jahrhundert. Etliche Argumente legen nah, dass er ebenfalls als Energiespeicher, aber für die Gemeinde Limbach dienen sollte oder gedient hatte.
Obermühle sowie weiter unten die Käfersteinmühle besaßen unmittelbar neben ihren Betrieben zusätzlich einen Schutzteich auf der für den Aufschlag notwendigen Höhe. Man kann sagen, er diente den Müllern auch als Anlaufhilfe für ihr Wasserrad. Der Obermühlenschutzteich lag auf dem deshalb terrassierten Hang unterhalb der jetzigen Kindertagesstätte Heinrichstraße sozusagen im Nebenschluss. Aber die Mühlenbesitzer dachten seinerzeit bei der Wasserbewirtschaftung wohl zwangsläufig weiter. Zum Mühlengut gehörte Wirtschaftsland vom Frohnbach bis nach Fichtigsthal. Es lag über den heutigen Wohngrundstücken Horst Strohbach-Straße. Der Weg den Berg hinauf, jetzt Teil der Straße des Friedens und der Viehweg entlang der jetzigen Hainstraße war oberhalb die Begrenzung.
Aus dem Gelände etwa ab heutiger Mittelstraße wurden ablaufende Niederschläge durch Hanggräben gesammelt und Richtung Mühle einem, dieser ebenfalls vorgelegenen, weiteren Teich zugeführt. Sickerwasser aus dem Gelände darüber kam hinzu. Jetzt befinden sich dort die Kleingärten an der Neuen Straße. Ein anschließender Graben führte dann auch in den Schutzteich der Obermühle. Nachweise darüber liegen bereits aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg vor. Diesen Vorteich hatte ab 1904 der örtliche Naturheilverein wegen seiner Quellzuläufe nach und nach zum ehemaligen Mietsgartenbad ausgebaut. Das Recht auf Überlaufwasser bestand auch für die Firma Rätzer nach späterer Betonierung des Schwimmbeckens weiter.
Dr. Schnurrbusch:
Die bereits 1859 gegründete Handschufabrikation von Heinrich Rätzer errichtete anstelle der abgebrannten Obermühle ab 1897 ein Fabrikgebäude.
Kommunenseitig stand aber Elektroenergie für Antriebe noch nicht zur Verfügung:
G. Schickl - Bräunsdorf:
Der Bau des Gemeindeelektrizitätswerkes Oberfrohna wird im September 1906 begonnen. Die Anlage ist für drei Dynamomaschinen konzipiert.
Deren Antrieb erfolgt über Flachriemen durch eine Sauggasmotorenanlage des Herstellers Gasmotorenfabrik Köln-Ehrenfeld. Das dafür benötigte Gas wird im neben der Maschinenhalle gelegenen Kesselhaus aus Braunkohlenbriketts mittels sogenannter Generatoren erzeugt.
Vorerst kommen zwei Gasmotoren mit 50 (37,4 kW) und 80 PS (60 kW) zur Aufstellung. Kühlwasser liefert das im gleichen Jahr dorthin verlängerte Wasserrohrnetz. Um Bedarf daraus niedrig zu halten, errichtete man im Hof einen hölzernen Kühlturm mit quadratischem Grundriss.
Die Dynamomaschinen erzeugen Drehstrom 3300 V. Anfangs gab es für wenige industrielle Verbraucher transformierten 220 V-Drehstrom und für Haushalte sowie ähnlichen Bedarf nur Gleichstrom mit 110 V. Den gewährleistete ein Quecksilberumformer.
1908/10 baute die Gemeinde Oberfrohna zum Anschluss der Orte Bräunsdorf, Kaufungen, Nieder- und Mittelfrohna/Fichtigsthal sowie Rußdorf ihr Elektrizitätswerk durch die Aufstellung der dritten Sauggasmotorenanlage von 175 PS (131 kW) weiter aus.
Handschuhfabrikant Rätzer erwarb daher den Standort auf jeden Fall mit wegen der rechtlich gesicherten und anlagenbaulich vorhandenen Wasserkraft. Nach dem nun 345 m langen Obergraben war an der Fabriknordseite, also etwa in Verlängerung des breiten Teils der Heinrichstraße, die Radkammer angeordnet. Ein eisernes Wasserrad von 5,5 m Durchmesser und 0,7 m Schaufelbreite trieb den werkseigenen Stromgenerator und über damals noch übliche Transmissionen für Handschuhfertigung notwendige Maschinen an. Ablaufendes Wasser floss nun zur Optimierung der Fallhöhe tiefer in einer deshalb 100 m langen Röhre zurück zum Frohnbach. Hinter den Gebäuden Nr. 54 bis 58 der jetzigen Frohnbachstraße (Friseur, Vogels Gaststätte und 1995 abgerissene Liebertschmiede) führt der dort noch offen in einen leichten Bogen entlang und dann abwärts straßenbegleitend verdeckt weiter.
Den Schutzteich ließ Heinrich Rätzer massiv ausbauen. Nach Plan von 1914 muss er in Form eines längeren Trapezes eine Fläche von etwa 1800 m² besessen haben. Das Zulauf und Entnahme regulierende hölzerne Schütz war 0,95 m breit und 1,2 m hoch. Unter Ansatz von 0,80 m mittlerer Stauhöhe konnten darin also durchaus 1500 m³ Wasser gespeichert werden. Den Boden hatte man wegen der Ablagerungen reinigungsfreundlich in Gefälle ausgeführt. Das Überlaufwasser des Mietsgartenbades brachte nun eine gesonderte Zementrohrschleuße (frühere Bezeichnung für Betonrohr) 200 mm lichter Weite heran.
Bereits 1865 musste sich der Obermühlenbesitzer beim Brückenbau über den Obergraben am Mühlberg/ Schulberg beteiligen. Die Fa. Rätzer beabsichtigte dann um 1900 auf ihren Grundstücken dort weitere Fabrikationsgebäude mit Wohnungen direkt in der Flucht des Promenadenweges zu errichten (Str. des Friedens 106 und 108). Die dafür erforderliche Umverlegung des Grabens erfolgte mittels Betonrohren hangseitig um den Bauplatz, d.h. ein Stück entlang im heute schmalen Teil der Heinrichstraße. Nach dem Wasserleitungsbau der Gemeinde im 2. Halbjahr 1905 sollte die Hauptstraße (jetzt Frohnbachstraße) im Jahr darauf ausgebaut und verbreitert werden. Schon aus Mühlenzeiten war immer wieder erhebliche Mückenplage bei entsprechender Witterung entlang des Obergrabens überliefert. Als Beitrag zur Verbesserung der Zustände, wohl auch aufgrund gemeindlichen Druckes ersetzte die Firma Rätzer den Oblauf zur Fabrik durch eine Zementrohrschleuse von 700 mm lichter Weite. Für Unterhaltungszwecke ordnete man Kontrollschächte an. Längs der Frohnbachstraße sowie als Querung der Straße des Friedens wurde sie, da relativ flach liegend, mit dem Kanal- und grundhaften Straßenausbau von 1994/95 entfernt. In einem gesonderten Flurstück entlang der Linden vom Promenadenweg und mit der Bezeichnung Mühlgraben ist diese Leitung noch vorhanden. Aber sie füllen als Folge der Jahre nach der Firmenpleite Ablagerungen fast vollständig aus.
Zur Stabilität des betrieblichen Energiebedarfs besaß die Firma noch eine kleinere Dampfmaschine. Dampf wurde sowieso für die damals verbreitete Heizungstechnik benötigt. Dafür sowie die bereits damals obligatorischen Waschgelegenheiten für die Beschäftigten benötigte die Fabrik von Beginn an sauberes Wasser. Das Oberfrohnaer Gemeindewasserwerk gab es noch nicht. Die neu errichtete Firma Rätzer musste eigene Möglichkeiten der Wassergewinnung finden. Mit im Obergraben lag über die Jahrhunderte eine hölzerne Wasserleitung aus einem Brunnen jenseits vom Frohnbachwehr. Die führte zum Röhrständer und Wassertrog der Obermühle. Nachdem diese abgebrannt war, fehlte die Zuständigkeit für deren Unterhaltung. Solche Art von Leitungen benötigen ständige Feuchte, auch außen.
Zumindest das aus mehreren Einzelquellen bestehende Grundwasseraufkommen im Bachtal fand bei Otto Schröder (Schröderstraße) Interesse. Als ausgebildeter Färber legte er dort zuerst eine mehr handwerklich betriebene Textilveredlung an. 1874 stieg er als Mitdirektor in die Aktienfärberei ein. Ab etwa 1905 bis vor dem II. Weltkrieg bestand übrigens an dem Standort gegenüber der Bergstraße eine Niederlassung der Färberei Rebske, Hauptbetrieb Limbach Weststraße. Auch einen Fischhändler Gränz mit Hältergelegenheit gab es dort wie auch in Limbach in den 1920ern.
Mit Ankauf des Obermühlengrundstückes übernahm Heinrich Rätzer einen großen Teil der früheren Landwirtschaftsflächen. Dadurch war es ihm möglich, auf diesen für seine Wasserversorgung Quellfassungen anzulegen und in seine Gebäude abzuleiten. Grund- oder Quellwasser gehörte damals zum Grundstückseigentum.
Beide der Schächte sind noch vorhanden, einer an der Neuen Straße aufwärts links und einer an der Industriestraße oberhalb des Färberweges. Höhenseitig genügte deren Lage, um im oberen Fabrikstockwerk Wasser aus den Hähnen laufen zu lassen. Erst mit Errichtung der Villa Rätzer um 1900 musste für diese über eine sogenannte Hydrophore, d.i. Pumpe und Druckkessel mit Teilluftfüllung, der Wasserdruck erhöht werden. Davon wurden dann auch die Gebäude an der Ecke zum Schulberg, heut Klempnerei Meyer, bis zum Ausbau der Oberfrohnaer Wasserversorgung versorgt.
Weiter unten vor dem Frohnbach war die Färberei Gränz (Färberweg) auch mit im vorherigen Mühlengrundstück angelegt worden. Verwandtschaft, vielleicht Erbteil, mit dem Mühlenbesitzer Gränz ( bis1816) könnte der Hintergrund gewesen sein. Diese Färberei besaß oberhalb des heutigen Kindertagesstättenanbaus ebenfalls eine Quellwasserfassung und dazu ein Mitbenutzungsrecht am Schutzteich. Dann in den 1920ern gehörte sie zu der von Hermann Emil Ernst. Jetzt befindet sich dort die Hofmann Kühlfahzeuge GmbH.
1925 ersetzte die Handschuhfabrik Heinrich Rätzer Nachfolger das Wasserrad durch eine 12 PS Francisturbine mit einer Schluckfähigkeit von 180 Liter pro Sekunde bei 6,5 m Nutzgefälle. Der Turbinentyp konnte auch bei weniger Wasseranfall und mit schwankender Fallhöhe laufen. Entsprechend geringer fiel natürlich die Leistung aus.
Für derartige Zwecke brachte man sie verbreitet einlaufseitig in einem Schacht unter.
Im Januar 1931 sah der Plan zur weiteren Frohnbachüberwölbung noch die Erneuerung der Wehranlage mit vor. Ob die Turbine damals bei der Insolvenz oder erst später beim Umbau durch die Gemeinde ausgebaut und verkauft wurde, war im Umfeld nicht mehr heraus zu finden. Sie könnte auch nur einfach verschüttet worden sein.
Ältere werden sich erinnern: In den ersten Jahren nach dem II. Weltkrieg kam es ständig wegen Kohlemangel zu täglichen Stromabschaltungen, selbst im Überlandsystem. Das nicht weit vom Standort entfernte Elektrizitätswerk der Stadt war sowieso im Schichtbetrieb besetzt. Notstromerzeugung aus Wasserkraft und Übertragung dahin hätte sich da angeboten. Aber Graben und Technik funktionierten scheinbar endgültig nicht mehr. Neubeschaffung eines Generators war in der Zeit sowieso illusorisch. Nur im Schutzteich haben noch 1948 Angestellte der Stadt Oberfrohna Fische aus den Waldteichen für die örtliche Lebensmittelversorgung gehältert. Auf keinen Fall eignete sich dafür der Zulauf aus dem Frohnbach. Oberhalb vom Wehr lagen schon lange weitere Färbereien ohne ausreichende eigene Abwasserbehandlung. Dazu kam die Verschmutzung durch reichlich häusliches Abwasser. Also kann nur das Hangquellwasser zu der Zeit allein den Teich gespeist zu haben. Es läuft heute noch in die Grundstücke. Auch soll nach dem Krieg laut Friseur Bula Senior im Schutzteich sogar ein Junge ertrunken sein. Vielleicht der Anlass, ihn endgültig zu beseitigen. Auf jeden Fall hatte vor dem Umbau zur Kaufhalle im Keller neben dem ehemaligen Triebwerksraum der Jostschuster seine Werkstatt und Schuhkleinfabrikation.
Am Ende bleibt mit jetzigem Auffinden der alten Radstube noch der Grund offen, warum sie nicht bereits beim Bau der Rätzerschen Handschuhfabrik mit verfüllt wurde.
Nachtrag:
Wasser auf Spielplätzen ist heutzutage verbreitet und vor allem bei Kindern beliebt. Ein Vorschlag aus der Oberfrohnaer Bürgerschaft empfahl im Bewusstsein des Standortes die Mitstationierung eines kleinen spielplatztauglichen Wasserrades als hydromechanische Demonstrationsanlage. Er wurde von der Stadtverwaltung zwar wohlwollend entgegengenommen, aber eben nicht realisiert. Wenigstens und ganz bescheiden gegenüber Oberfrohnaer Vorgehensweise als eigenständige Kommune haben wir jetzt eine modernere Handpumpe, die aus dem Trinkwassernetz gespeist wird.
Reinhard Käferstein
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 10. Juni 2021 -
Merkwürdige Steine im Hohen Hain
Wir unternehmen unseren Waldbummel mit offenen Augen. Verschiedene Dinge sind es, die uns da zum geschichtlichen Denken und Studieren veranlassen, die Grenzsteine, die Steingruben und -brüche, die baum- und buschbewachsenen Wege. Sie liegen offensichtlich für jedermann und sind uns Derzeitigen beredte Belege dafür, wie der Wald von dem kultur- und volkswirtschaftlichen Treiben der heimatlichen Vorbewohner vor Jahrzehnten und Jahrhunderten mit geformt wurde.
Auffällig ist uns die Uneinheitlichkeit der Grenzsteine nach ihren Standort sowohl, als auch in ihrer Form. Grenzsteine erfüllen ihren Zweck und kommen ihrem Name nach, wenn ihre Verbindungslinie die Umfanglinie des Grundstückes ist. Im Hohen Hain hat aber eine Menge Grenzsteine auch mitten im Waldgelände ihren Platz. Was sollen und wollen diese Sonderlinge hier? Böswillig versetzte sind sie auf keinen Fall. Dafür ist ihre Zahl zu groß. Sie sind vielmehr jedem Beobachter ein Fingerzeig dafür, dass die heutige Gesamtfläche des Waldes nicht zu jeder Zeit auch einheitlich in der Besitzzugehörigkeit gewesen ist. Dadurch erklärt sich auch die Verschiedenheit der Grenzsteine in ihrer Form und Material. Die Gesteinsmasse ist bei einem Teile Glimmerschiefer, bei dem anderen Rochlitzer Porphyr, bei einem dritten Granulit. Die einen hat der Steinmetz zu Grenzsteine zugerichtet, die andern sind ungeformte Bruchsteine. Manche tragen gar sein Zeichen, andere nur eine Nummer. Eine dritte Sorte ist bezeichnet mit Nummer und Buchstaben, entweder mit RL = Rittergut Limbach oder mit G v W = Graf von Wallwitz.
Quelle: Limbacher Heimat-Studien 1933, geschrieben von Paul Fritzsching
Fotos: Michael Nestripke, Förderverein Esche Museum
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 27. Mai 2021 -
Kriegsende 1945
Im Januar kamen immer mehr Flüchtlinge aus Schlesien (Oppeln, Brieg, Breslau) hier an und wurden in Limbach, Oberfrohna, Pleißa, Kändler in Privatquartieren untergebracht. Die Pestalozzischule wurde noch zu einem Lazarett, das aus Guhrau (Schlesien, heute Góra, Polen) hierher verlegt worden war. Lazarette waren schon eingerichtet im Krankenhaus, in den Schulen III (Pleißaer Straße), Oberfrohna, Rußdorf, Berufsschule, im „Schweizerhaus“, in der „Parkschänke“, im Gasthof „Weißes Ross“ (Pleißa) und im „Jahnhaus“. In diesen Lazaretten lagen mehr als 3.000 verwundete Soldaten.
Am Dienstag, dem 6. Februar 1945, bombardierte eine Staffel amerikanischer Flugzeuge in Oberfrohna den Bahnhof, auf dem zwei Lazarettzüge standen und trafen besonders den Ortsteil westlich vom Jahnhaus - Sportplatz, Siedlerweg, Rußdorfer Straße, Rosenhof. Hier wurden nach dem Angriff 85 Bombentrichter gezählt. Es kamen 13 Zivilisten ums Leben, davon sieben Frauen und zwei Kinder. Sie wurden auf dem Oberfrohnaer Friedhof beerdigt, wo ihre Gräber noch zu sehen sind. In die Zeit von Januar bis April 1945 fielen die verheerenden und vielfach wiederholten Bombenangriffe auf Dresden (13.2.), Leipzig (27.2.), Chemnitz (5.3.) und Plauen (10.4.) mit Tausenden Toten und zerstörten Städten.
Am 18.2.1945 wurde das 2. Aufgebot des Volkssturms[1] vereidigt. Bataillonsführer war der Limbacher Bürgermeister Dr. Jokesch. Der Volkssturm wurde zu Aufräumungsarbeiten in das zerstörte Chemnitz geschickt und im Umgang mit Waffen unterwiesen. Am 25.3. wurde auch noch das 3. Aufgebot des Volkssturms vereidigt, die 16- bis 20-Jährigen. Die Jahrgänge 1927 und 1928, also die 17- und 18-Jährigen waren jedoch bereits 1944 zum Wehrdienst eingezogen worden, so dass das 3. Aufgebot fast ausschließlich aus 16-jähri-gen Hitlerjungen bestand. Jokeschs Plan war, Limbach zu verteidigen. Er hatte die Stadt zum Kampfgebiet erklärt und Wehrmacht nach Limbach gezogen: Langrohrgeschütze im Hohen Hain und Gemeindewald, eine Raketen-Werferbatterie in Grimms Steinbruch. Die Geschütze kamen nicht zum Einsatz, die Werfer feuerten immerzu in der Nacht zum 14.4.
Ab 5.4.1945 wurde Limbach und Oberfrohna immer häufiger von Tieffliegern mit Bordwaffen angegriffen. Es gab Tote und Verwundete. Am 12. und 13. April kam es zu Alarmierung und Einsätzen des Volkssturms. Es sollten Panzergräben und Hindernisse gebaut werden. Volkssturm-Kompanien wurden nach Pleißa befohlen, in den Rabensteiner Wald, die „Kompanie Meisel“ nach Niederfrohna. Hitlerjungen sollten mit Panzerfäusten die Amerikaner aufhalten. In Niederfrohna und Rußdorf wurden Panzersperren gebaut, die Brücke der Autobahn zwischen Kändler und Rabenstein gesprengt. Es kam am 13. und 14. April 1945 zu Schusswechseln mit den vorrückenden Amerikanern, jedoch nicht zu größeren Kampfhandlungen. Am 13. und 14.4. erreichten die Amerikaner die Rußdorfer Höhe, die Kaufunger Höhe (Jahnshorn) und Niederfrohna (Gasthof „Eiche“) und beschossen den unteren Teil von Rußdorf, die Haupt- und Oststraße in Oberfrohna und die Helenenstraße in Limbach. Der größte Teil des Volkssturms hatte sich selbst aufgelöst in der Erkenntnis, dass ihr Einsatz völlig sinnlos war. Ein Teil zerstreute sich am Bismarckturm in Borna, andere wurden gefangen genommen und in der Fa. C.A. Kühnert, Limbach, Chemnitzer Straße 71, eingesperrt. Am 14.4.1945 kam vom Wehrmachtskommandanten des Volkssturms, Hauptmann d. R. Barthel, der Befehl: „Volkssturm ist aufgelöst, alle Unterlagen vernichten!“ Barthel hatte sich gegen den Bürgermeister Jokesch durchgesetzt, der Limbach durchaus „verteidigen“ wollte. Am 15.4.1945 waren auch die Reste des Volkssturms nicht mehr vorhanden.
Rußdorf: Am 14.4. hatten im unteren Ortsteil noch 45 deutsche Soldaten den vorrückenden Amerikanern Widerstand geleistet und drei getötet. Die Amerikaner beschossen darauf mit Panzerkanonen mehrere Häuser und Bauerngüter, wodurch fünf Zivilisten und drei Wehrmachtsangehörige getötet wurden. Die Amerikaner rückten vor und durchsuchten die Häuser nach deutschen Soldaten. Zwei wurden in einem Keller an der Folgenstraße entdeckt. Sie ergaben sich, wurden gefangen genommen und am Folgenbach erschossen. In Rußdorf brannten 23 Gebäude und eines in Falken. Die Brände waren wohl durch den Beschuss entstanden, vielleicht auch von polnischen Zwangsarbeitern angezündet.
Oberfrohna: Am Freitag, dem 13.4. heulten in Limbach und Umgebung die Sirenen: Panzeralarm! Am Abend war Geschützdonner aus Westen zu hören. Die meisten Einwohner verbrachten die Nacht im Luftschutzkeller. Am Vormittag des 14. 4. rückten die Amerikaner über Rußdorf und Kaufungen nach Oberfrohna vor. Aus vielen Häusern hingen weiße Fahnen. Schüsse aus Panzerkanonen trafen u.a. die Oberfrohnaer Schule, mehrere Häuser und eine Fabrik, es gab zwei tödlich Verletzte. Die Steinertsche Fabrik an der Wol-kenburger Straße 3 geriet in Brand. Dr. Lässer, ein Arzt im Lazarett, ging den amerikanischen Truppen auf der Kaufunger Straße mit einer weißen Fahne entgegen. Vermutlich hat er damit viel Unheil abgewendet. Auf der Nordstraße drohten SA-Männer, Häuser anzuzünden, an denen eine weiße Fahne gezeigt würde. Gegen Mittag gingen die Ärzte und Beamten auf die Panzer zu und übergaben den Amerikanern die Verwundeten des Lazaretts in der Oberfrohnaer Schule. Häuser an der Hainstraße und Lindenstraße mussten zur Einquartierung geräumt werden, Fahrzeuge der US-Armee parkten in der Hainstraße unter den Bäumen. Die Panzer fuhren auf der Hauptstraße weiter in Richtung Limbach.
Limbach: Die Amerikaner beschossen am Vormittag Helenenstraße, Johannisplatz und andere Gebäude. Gegen 14.30 Uhr erschienen die ersten amerikanischen Fahrzeuge und nahmen die Stadt in Besitz. Die Bemühungen Jokeschs, der Limbach unbedingt verteidigen wollte, wurden durch den Chefarzt der Lazarette und Wehrmachtsoffiziere vereitelt, die veranlassten, dass weiße Fahnen gezeigt wurden. Jokesch erschoss seine Familie und sich. Amerikanische Truppen drangen bis zum Rathaus vor und setzten den Beigeordneten Thierfelder als Kugelfang auf die Motorhaube eines Jeeps. Er musste die Amerikaner bis zur Ostgrenze der Stadt führen. Amtsleiter der NSDAP wurden Im Hotel Central festgesetzt, später in Lager transportiert. Der amerikanische Kommandant hatte seinen Sitz im Rathaus, alle Wehrmachtsangehörigen mussten sich melden. Sie wurden abtransportiert und in Lager gebracht (u.a. Bad Kreuznach-Bingen). Am 20.4. brannten Amerikaner die Häuser Albertstraße 6 und Frohnaer Str. 3 nieder, weil angeblich daraus auf sie geschossen worden sei. Wehrmachtslager wurden geplündert. Die Amerikaner beschossen mit schwerer Artillerie von Pleißa aus Chemnitz.
Dr. Herman Schnurrbusch (2015)
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 27. Mai 2021 -
Die Jubellinden in Oberfrohna
Der Anlass der Pflanzung dieser Linden vor ca. 180 Jahren war, die 300 jährige Wiederkehr der „Augsburger Konfession“, wo am 25.6.1531 die lutherischen Protestanten dem deutschen Kaiser Karl V. auf dem Reichstag in Augsburg die evangelische Bekenntnisschrift vorlegten. In Folge dessen entwickelte sich, besonders durch das Wirken von Martin Luther, oberhalb der Main-Linie in Deutschland überwiegend der evangelische Glaube.
Im Juni 1831 wurde in Oberfrohna diesem 300 jährigen Jubiläum gedacht und die Schuljugend pflanzte feierlich und „unter großem Jubel“ unter der Anleitung von Lehrer Reinhold Kühnert eine Linde auf der Anhöhe an der damaligen Limbacher Straße. Nachdem die erste Linde offenbar einging, denn im Juni ist keine Pflanzzeit, wurde im Oktober 1839 zum Reformationsfest oben auf dem Schulberg nach dem Kirchgang, die Pflanzung von weiteren drei Lindenbäumen vorgenommen. Diese drei Linden sollten drei Jahrhunderte des lutherischen Bekenntnisses symbolisieren. Ein Pfarrer gab wie üblich seinen Segen dazu. Sogar eine Schar von weißgekleideten Schulmädchen die Girlanden schwenkten, Kränze trugen und fromme Lieder sangen umrahmten das Volksfest. Der Kirchenchor wirkte ebenfalls mit - so konnten die Bürger es dann in den nächsten Tagen in der Zeitung lesen. Der Landwirt Gottlob August Kühn stellte für die Anpflanzung der Linden ein Stück seines Grundstückes und die jungen Bäume zur Verfügung.
Auf Foto-Ansichtskarten der 30er Jahre erscheinen diese Jubellinden aber gar nicht wie 100-Jährige, sie hätten dann einen Stammdurchmesser von ca. 1,20 Meter haben müssen und wären mächtige Bäume gewesen. Auch auf einem Foto-Dia zu Beginn der 1930er Jahre aus dem Fundus des Esche-Museums sind das noch relativ junge Bäume. In der Gründerzeit und im beginnenden Automobilzeitalter mussten Straßen neu gestaltet werden. Dazu gehörte auch die Verkehrsinsel mit den Jubel-Linden am sogenannten Schulberg bzw. am Beginn der Hainstraße. Bäume gingen auch mal verloren, sei es durch Vandalismus oder durch ausgebüxte Tiere.
Überlieferungen über die damalige Neupflanzung wurden in den Archiven bisher nicht gefunden. Man erwog sogar im Jahre 1931 wegen Pflasterungsarbeiten am Schulberg bzw. an der Einmündung der Hainstraße, die Bäume zu fällen. Man gab jedoch diesen Plan wieder auf und schuf dort die heute noch bestehende dreieckige Verkehrsinsel. Die auf den Ansichtskarten der 1930er Jahre abgebildeten drei Jubellinden wurden bereits 1958 zum Naturdenkmal erklärt und bekamen am Stamm das bekannte gelbe Eulenschild. Sie waren dann in den 1990er Jahren teilweise mit dürren Ästen besetzt, die nach Stürmen schon mal abfielen und bei einigen Leuten Hysterie auslösten. Nun war guter Rat teuer. Ein Baum-Gutachten des Prof. Tesche aus Tharandt von 1997 wies die Linden als standsicher und „durchaus erhaltenswert“ aus. Zu diesem Zeitpunkt waren noch drei Linden vorhanden. Ein vom Landratsamt Zwickau dann in Auftrag gegebenes Gefälligkeitsgutachten bezweifelte jedoch im Jahre 2007 plötzlich die Standsicherheit der Jubellinden, denn alte Bäume bedeuten immer ein Risiko, so das Landratsamt „Ein Baum ein Problem – kein Baum kein Problem“. Wie kann es sein, dass zwei Baumexperten zu so unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Eine Sicherung der Linden mit z.B. Bandagen war möglich, wäre aber angeblich zu aufwändig und zu teuer gewesen befanden die Zwickauer. Inzwischen standen dort nur noch zwei Bäume. Ein Baum war allerdings hohl. Die stärkere der Linden hätte man mit wenig Sicherungsmaßnahmen durchaus erhalten können. So wurden die zwei noch vorhandenen Linden im Januar 2009 unter Protesten der Bürger und besonders vom Heimatverein Oberfrohna gefällt. Das waren aber nicht mehr die Bäume von 1839, denn zwischen Alter und Stammumfang besteht ein ursächlicher Zusammenhang. Die offensichtlich übertriebene Sorge um die Verkehrssicherungspflicht überwogen die Bürgerproteste, so dass das Landratsamt als Aufsichtsbehörde die Fällung der beiden Naturdenkmale veranlasste. Die stärkere Linde wies nach der Fällung durchweg gesundes Stammholz am Baumstumpf aus. Am Reformationstag 2009 wurde dann feierlich eine junge Linde vom Stadtoberhaupt und dem Oberfrohnaer Pfarrer gepflanzt. Man befand, dass dieses Straßen-Dreieck am Schulberg/Hainstraße nur noch einen Baum verträgt. Die Verkehrsinsel ist heute neu gestaltet. Durch die Stadtverwaltung wurde wie vordem, neben der Linde ein großer Naturstein mit einer Gedenkinschrift aufgestellt. Manche Bürger und Naturfreunde fragen sich, wie können Leute aus dem weitentfernten Zwickau über das Schicksal unserer denkwürdigen Bäume entscheiden.
Friedemann Maisch
Quelle: Gemeindebuch-Oberfrohna 1839, Stadtspiegel 10/2009
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 15. April 2021 -
Der Limbach
Die Zeit, als Helena Dorothea von Schönberg in dem damals bäuerlich geprägten Dorf Limbach die Siedlungshäuser auf dem Helensberg und Dorotheenberg anlegen ließ, datiert auf das 18. Jahrhundert. Damals dürfte der Limbach noch als silbernes, klares und in der Sonne glänzendes Bächlein durch das Limbachtal geflossen sein, um sich dann in gerader Richtung zwischen Kellerwiese und Hohen Hain ca. 200 Meter oberhalb der jetzigen Hochwasserschutzanlage Knaumühlenteich mit dem Pfarrbach zu vereinen.
Nunmehr wohne ich seit 62 Jahren in dieser Stadt und kenne noch die Stelle, wo aus einem großen Rohr hinter der Färberei Roscher (heute der hintere Teil des Kundenparkplatzes von Hunde-Netto) ein übel riechendes Wasser in ein betoniertes Bachbett floss. Diesen Bachabschnitt bis zum Knaumühlenweg nannten die Limbacher wegen der darin enthaltenen Fäkalien „Würschtelbach“.

Der „Würschtelbach“ in seinem Betonbett (Foto: Dietrich Donner)

Jetzt läuft der Limbach verrohrt durch die Kleingartenanlage „Bodenreform“, hier mit einem Einstiegsschacht (Foto: Reiner Wagler)
Anfang der 1990er Jahre wurde dieser offene Bachabschnitt des Limbachs in ein großes Rohr bis zur Straße Am Quirlbusch verlegt, um von dort durch eine unterirdische Vorkläranlage etwa 100 Meter talwärts sich mit dem Pfarrbach zu vereinen. Wo aber befinden sich die Quelle des Limbachs und sein Bachtal?

Etwa 200 m unterhalb des Knaumühlenteichs, schon auf Niederfrohnaer Gelände, plätschert der Pfarrbach. Er hat den Limbach aufgenommen. (Foto: Reiner Wagler)
Mitglieder des Fördervereins Esche-Museum e. V. entdeckten im Sammlungsbestand einen der „Heimatlesebogen“ des Lehrers und Heimatforschers Paul Fritzsching, den er der Geschichte des Limbachtales gewidmet hat. Er lässt den Limbach selbst als Erzähler über die Entwicklung und seinen Bachlauf berichten. Der Limbach beklagt seine unterirdische Verbannung in „abscheuliche, finstere Schleusen“ und die Verschmutzung mit stinkenden Haushalt- und Färbereiabwasser. Das Thema Umweltverschmutzung war schon zur Lebenszeit Paul Fritzschings nicht neu. Er nennt die Quelle des Limbachs und schreibt „Sage mir, wo ist denn dein Tal in der Stadt eigentlich?“
„Du aber höre: Meine Quelle liegt unter Kirchhofs Obstgarten an der Chemnitzer Straße...“
Ich selbst habe mit meiner Familie zwölf Jahre in dem großen Eckhaus Lessingstraße-Oststraße gewohnt und konnte auf den Rest des Obstgartens des bäuerlichen Anwesens Kirchhof schauen, in dem eine Schar Hühner herumlief, über die sich meine damals kleine Tochter beim Vorbeigehen auf der Chemnitzer Straße sehr freute. Dort hatte auch der VEB Stadtwirtschaft seinen Sitz. Mit der Vergrößerung des Fahrzeugbestandes für die Müll-, Fäkalien-, Container- und Schneeberäumung wurde der Obstgarten mit Garagen und einem Sozialgebäude bebaut. Heute befindet sich nach dem Abriss der Gebäude auf dem Gelände die RSP Opel Autolackiererei, Bilgro Getränkemarkt, das Dänische Bettenlager und eine große betongepflasterte Parkfläche.

Heute wird das Quellgebiet des Limbachs von dieser Parkfläche abgedeckt. (Foto: Reiner Wagler)
Nach der Unterquerung der Chemnitzer Straße fließt der Limbach berohrt unter dem Artisedahof zur Marktstraße und dem Markt. Im Frühjahr 2016 brach die Bachunterführung am Markt in einer Größe ein, in der zwei PKW Platz gefunden hätten. War das ein vergeblicher Versuch des Limbachs wieder ans Tageslicht zu gelangen? Am Markt erhält der Limbach einen stetig fließenden Zufluss von der Hanglage des Wohngebietes am Wasserturm. Die Quelle befindet sich am unteren Ende des Kindergartengrundstücks an der Professor-Willkomm-Straße. Mit diesem Quellwasser befüllen die Mitarbeiter des Bauhofs die Behälter des Gießwagens und der Straßenkehrmaschine. Nach der Durchquerung des Marktplatzes und des Anfangs der Weststraße fließt der Limbach unter dem Hof der Turmpassage, der Moritzstraße, der Höfe von Gebäuden an der unteren Hechinger Straße zur Bachstraße. Von dort unter der Jägerstraße, Anfang der Peniger Straße und der Kellerwiese, dann Richtung Parkplatz vom Discounter Hunde-Netto. Der weitere Verlauf wurde bereits oben beschrieben.

Das Bachtal gegenüber der Turmpassage (Foto: Reiner Wagler)
Heute kann man an drei Stellen im Stadtgebiet die Talsohle des Limbachs sehen, die nicht durch Bodenauffüllungen zugeschüttet wurden: die Geländevertiefung bei der Schleiferei Bley, rechts der Bachstrasse bis zum großen Parkplatz vor dem Tedi-Markt und am Anfang der Peniger Straße links vor dem Limbomar, wo früher die Gaststätte Bräustübl stand.
Paul Fritzsching schreibt: „Aber eine Freude ist mir (er meint den Limbach) endlich einmal dadurch zuteil geworden, dass man in eurem Rat der Stadt auf den weisen Gedanken kam, die Verbindungsstraße zwischen dem Johannisplatz und der Jägerstraße mir zur Ehre „Bachstraße“ zu nennen. So werden die Limbacher mich wenigstens nicht ganz vergessen.“ Ich muss gestehen, die Herkunft des Straßennamens war mir bisher nicht bekannt. Ich nahm an, dass er zu Ehren des Komponisten Johann Sebastian Bach gewählt wurde.
An dieser Stelle möchte ich das beachtlich große Einzugsgebiet des Limbachs darstellen. Es umfasst die zum größten Teil durch Überbauung versiegelten Flächen der Chemnitzer Straße bis zur Wasserscheide Höhe Lidl-Markt, weite Teile der Hohensteiner Straße, der Pleißaer Straße, die Albert-Einstein-Straße, das Wohngebiet am Wasserturm, die Weststraße, Sachsenstraße, Helenenstraße, Albertstraße, Dreiviertel der Straße des Friedens, die Hainstraße, das Wohngebiet Paul-Fritzsching-Straße, die Peniger Straße, das Wohngebiet zwischen Knaumühlenweg und Am Quirlbusch und das Wohngebiet Am Hohen Hain, um nur die wesentlichen Flächen zu nennen.
Bei Betrachtung einer Karte des dörflichen Limbach aus dem Jahr 1785 überrascht die große Anzahl längst verfüllter Teiche, die ihrem Abfluss in den Limbach hatten oder durch die der Limbach selbst floss. Diese Karte wurde von den Heimatforschern Fritzsching und Seydel nach einem historischen Vorbild gezeichnet und ist in der vom Vereinsmitglied Dietrich Donner, dem Initiator des Stadtlehrpfades, in der Broschüre zum Stadtlehrpfad abgebildet.
An der Stelle des Kirchhof‘schen Obstgartens, der Quelle des Limbachs, befand sich ein etwa 1,5 Hektar großer Teich, dahinter noch ein kleinerer Teich. An der Marktstraße durchfloss der Limbach zwei Teiche, den Helder- und den Schwemmteich. Zwischen der unteren Pleißaer Straße und der Chemnitzer Straße befanden sich ein größerer und drei kleinere Teiche. Entlang der Moritzstraße bis zum Bereich der Bachstraße war die „Dorfwiese“. Hier durchfloss der Limbach zwei weitere Teiche. Auf der Fläche des Johannisplatzes befand sich der Tiefe Teich. Ein etwa zwei Hektar großer Teich bedeckte die Kellerwiese zwischen Limbomar und Peniger Straße. Weitere fünf mittelgroße Teiche befanden sich auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerkes an der Straße des Friedens.
Ein kritisches Areal ist die Kanalisation des Limbachs im Bereich des Johannisplatzes, der Bachstraße und der unteren Jägerstraße. Bei Starkregen floss das Oberflächenwasser durch das Gefälle von Moritzstraße, Albert-Einstein-Straße, Weststraße, Sachsenstraße, Helenenstraße, Albertstraße zur Bachstraße. Hier kam es oft zu einem Rückstau und drückte in die Keller der Gebäude an der Hechinger Straße und des Johannisplatzes. Während meiner Tätigkeit als Hausmeister im Gebäude der Commerzbank hatte ichzweimal das zweifelhafte Vergnügen, die Kellerräume von eingedrungenen Schmutz-wasser zu reinigen. Aus den Bodeneinläufen drang bei Gewitterplatzregen Kanalisationswasser aus und wurde beim Nachlassen des Niederschlags mit einem gurgelndem Geräusch wieder eingesogen. Doch keine Sorge liebe Limbacher. Der am tiefsten Punkt im Gebäude befindliche Tresorraum war nicht hiervon betroffen. Eure in den Schließfächern deponierten Wertpapiere, Geldscheinchen und sonstigen Klunkern können im Limbach nicht wegschwimmen, da dort kein Bodeneinlauf vorhanden ist. Die in den vergangenen Jahren durchgeführte Kanalerneuerung mit Querschnittsvergrößerung im Bereich Bachstraße-Jägerstraße hat diesen Missstand behoben.
Reiner Wagler
Förderverein Esche-Museum e.V.
Verein zur Pflege der Industrie- und Heimatgeschichte
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 11. April 2021 -
Ehemalige Bahnlinie Limbach-Kändler-Wüstenbrand

Der Bahnhof „Limbach (Sachs)“ wurde kürzlich zurückgebaut. Nur wenig erinnert nun an die ehemalige Bahnanbindung unserer Stadt. Im Ortsteil Kändler gibt es noch eine „Bahnhofstraße“ und eine Straße “Am Bahnhof“. Das macht neugierig, das fordert dort die Suche nach einem Bahnhof geradezu heraus. Neben Limbach war Kändler früher reichlich mit Industrie, Handwerk und Gewerbe gesegnet. Was lag da näher, gute Verkehrsverbindungen zu schaffen, die einerseits Rohstoff- und Energielieferungen (Kohle), andererseits den Absatz der Waren sichern mussten. Die Flur von Kändler wurde bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts von zwei Eisenbahnlinien geschnitten – die Wittgensdorf-Limbacher und die Wüstenbrand-Limbacher Strecke. Im Beitrag geht es um den Streckenteil ab Kändler. Jahrzehntelang konnten die Einwohner von Kändler von ihrem Bahnhof aus mit dem Zug in alle Ziele in Deutschland starten. Mit nur einmal Umsteigen hätte man, wenn damals Zwickau die Kreisstadt gewesen wäre – in weniger als einer Stunde in Zwickau sein können.

(Die grüne Linie auf dem Kartenausschnitt zeigt die Bahnlinie „Limbach-Kändler-Röhrsdorf/Löbenhain-Rabenstein-Grüna ( danach gemeinsam weiter auf Linie <C-Altendorf-Wüstenbrand>) -Wüstenbrand“)
Wie es begann:

Aus der Chronik: „Es hatte sich als notwendig herausgestellt, vom Lugau-Ölsnitz-Gersdorfer Steinkohlengebiet dem Limbacher Industriegebiet die dringend nötigen Steinkohlen zuzuführen“ . Im Sächsischen Landtag erfolgte 1893/94 die Genehmigung zum Bahnbau Limbach-Wüstenbrand, der an beiden Endpunkten im März 1896 begann. Am Bahnbau waren im Mai 1896 537 Mann beschäftigt, vorwiegend italienische Gastarbeiter. Die Hochbauten wurden von ortsansässigen Firmen errichtet. Am 30.11.1897 erfolgte die feierliche Eröffnung des Bahnbetriebes. Es fuhr ein Sammelzug von Limbach (8:45 Uhr) über Kändler (8:53), Röhrsdorf (9:01), Rabenstein (9:14), Obergrüna (9:25) mit Ankunft um 9:32 Uhr in Wüstenbrand. Es folgten dann zwei Festzüge in beiden Richtungen jeweils von den Endstationen. In Rabenstein gab es ein Frühstück, das Festmahl wurde im großen Saal des Hotels „Zum roten Hirsch“ (heute Stadthalle Limbach-Oberfrohna) eingenommen. Nach all dem Jubel begann am 1.Dezember der planmäßige Personen- und Güterverkehr auf der ca. 12 km langen Strecke.
Die Haltestelle Kändler wurde am 1. Dezember 1897 eröffnet und 1905 zum Bahnhof hochgestuft. Später dann als Ladestelle bis 1996 geführt. Am 31. Dezember 1950 wurde wegen der geringen Verkehrsbedeutung der durchgehende Betrieb eingestellt. Am 29.12.50 fuhr der letzte Zug nach Wüstenbrand. Ab April 1951 begann der Abbau der Gleisanlagen zwischen Röhrsdorf und Abzweig Schützenhaus Grüna (heute Forsthaus). Die Abzweigstelle „Schützenhaus“ wurde bis 1952 zunächst noch für den Baustofftransport des „Kulturpalastes der Wismut“ in Rabenstein genutzt, bis auch dort die Gleise abgebaut wurden. Die Strecke Kändler bis Bahnhof Röhrsdorf wurde gelegentlich bis 1959 im Güterverkehr bedient und für Übergabefahrten zum Bau des Zentralen Umspannwerkes (ZUW) in Röhrsdorf genutzt. Nachdem diese Nutzung 1994 eingestellt worden ist, erfolgte die Stilllegung am 6. Juni 1996. Die Gleise waren übrigens keine Reparationsleistungen an die Sowjetunion, sondern wurden für die Behebung der Kriegsschäden an den Hauptstrecken und für neue Strecken zur Umfahrung Berlins benötigt, was der damaligen besonderen politischen Situation geschuldet war.
Bahnhof einst:


Haltepunkt und Güterschuppen


ehemaliges Bahnhofshotel und Bahnhofsgelände heute
Von den Bahnanlagen ist nichts mehr zu sehen. Das Gebäude „Am Bahnhof 1“ war das Bahnhofshotel. Dort wurden die Fahrkarten vom Wirt K. August Heinrich verkauft. Sogar Übernachtungsmöglichkeiten waren vorhanden. Heute ist es ein Wohnhaus. Das Verwaltungsgebäude des früheren hinteren Güterschuppens wird heute von einem Mineralölhandel genutzt.
Die Strecke ist zwar nicht mehr in Betrieb, ist aber ein verkehrstechnisches Kleinod, dessen Reiz man auf einer Wanderung entlang der alten Bahnlinie erschließen kann. Bedeutsam sind die Brückenbauwerke bzw. der insgesamt sehr interessante Verlauf in reizvoller Umgebung.
Gleich nach dem Bahnhof Kändler führt eine Brücke über die Hauptstraße , gefolgt von der großen Brücke über den Pleißenbach. Eine Zementstampfbetonbrücke mit Betongelenken. Ausgeführt von der Firma „Cementwaarenfabrik“ Windschild & Langelott aus Cossebaude. Die Auritztalbrücke, im Volksmund eher als „Schramm-Karl-Brücke“ nach dem Erbauer bekannt, führte über die Bundesautoba hn A 4, ein sogenanntes Gerüstpfeiler-Viadukt, der 1976 abgerissen wurde. Es muss spannend gewesen sein, wie 1936 die Autobahn unter das Bauwerk „gefädelt“ worden ist. Ob die früheren Brückenbauer schon ahnten, dass vierzig Jahre später ein modernes Straßenverkehrsprojekt verwirklicht werden wird?

Brücke Hauptstraße


Viadukt Pleißenbach (Foto: Thomas Böttger)

Auritztalbrücke über BAB4
Das Viadukt Rabenstein in Nähe „Café Schmidt“ ist wahrscheinlich ebenfalls von Karl Schramm projektiert worden. Es steht unter Denkmalschutz und soll saniert werden. Wie die „Freie Presse“ am 25.9.20 berichtete, wollen die Stadträte von Chemnitz an der Sanierung des Brückenbauwerkes festhalten. Dafür sollen 1,5 Millionen Euro aus DDR-Parteivermögen zur Verfügung stehen. Eine Plakette an einem Brückenpfeiler nennt einige Daten zum Viadukt.

Brücke über die Oberfrohnaer Straße bei „Cafe Schmidt“ Rabenstein
Die ehemaligen Bahnhöfe in Röhrsdorf und Rabenstein existieren nicht mehr. Die einst beliebte Bahnhofsgaststätte Röhrsdorf befand sich am östlichen Rand des Zentralen Umspannwerkes. Der ehemalige Bahnhof „Grüna (Sachs) ob Bf“ wird als Wohnhaus genutzt.
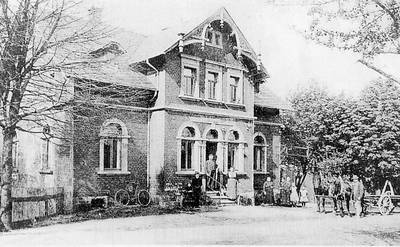
ehem. Bahnhofsgaststätte Röhrsdorf

ehem. Bahnhof Rabenstein

ehem. Bahnhof Grüna
Nahe dem Forsthaus Grüna befand sich eine filigrane, wie auf Stelzen stehende Brücke aus Eisen. Diese wurde abgerissen, der Damm weiter aufgeschüttet, die Lücke durch eine Betonbrücke ersetzt. Das auf dem Bild zu sehende Bauwerk ist die durch Stahlbeton später ertüchtigte Brücke. Dies war notwendig geworden, da zur Sicherung der Kohleversorgung des Chemnitzer Heizkraftwerks Nord eine Ausweichstrecke aus Neukieritzsch vorgehalten worden war, um auf mögliche Havarien der Hauptstrecke schnell reagieren zu können.

Brücke neben „Forsthaus Grüna
Erwähnt werden soll auch eine „besondere“ Brücke auf der Bergstraße (heute Kreisigstraße Rabenstein) über die Bahnlinie. Einige Strumpfwirkergesellen fuhren zur Einweihung im September 1897 mit einem Eselskarren, der mit einem Strumpfwirkerstuhl beladen war, über diese Brücke. So bekam sie den Spitznamen Eselsbrücke. Heute erinnert ein kleines Denkmal noch daran.

Denkmal Eselsbrücke
Ausblick
Für die Stadt Limbach-Oberfrohna mit Ortsteil Kändler ist längerfristig eine Wiederanbindung an den Schienenpersonenverkehr geplant. Mit dem „Chemnitzer Modell“ Stufe 4 sollen noch die ersten 4 km des Bahngeländes ab Bhf. Limbach genutzt werden, danach die ehemalige Verbindung nach Hartmannsdorf/Chemnitz-Center in die Innenstadt Chemnitz. Lt. VMS (Verkehrsverbund Mittelsachsen) wird für die komplette Fertigstellung das Jahr 2030 angepeilt.
Wenn man mal die eingangs genannte Bauzeit für die 12 km Bahnstrecke von Limbach nach Wüstenbrand mit diesen tollen Viadukten, Brücken und Unterführungen vergleicht, darf getrost der Hut vor den Leistungen unserer Vorfahren gezogen werden.
Den vielen Unterstützern, die mich in vielen Gesprächen mit Hinweisen, Ideen und Bildmaterial unterstützt haben, sage ich hiermit Dankeschön, ganz besonders bei Herrn Dr. Horst Bretschneider und Herrn Renè Müller, für seine Sammlung historischer Postkarten und Fotos! Für die technischen Angaben erhebe ich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und übernehme keine Haftung.
Michael Sieber
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 4. März 2021 -
Bruno Arthur Müller (1868 - 1938) - ein Lehrer im Kampf gegen die Tuberkulose
Der Würzburger Physikprofessor Wilhelm Conrad Röntgen entdeckte 1895 die nach ihm benannten Strahlen. Er nannte sie „X-Strahlen“, wie sie im anglo-amerikanischen Sprachbereich noch heute heißen: „X-Ray“. Röntgen verzichtete auf die Patentierung seiner Entdeckung und damit auf Millionengewinne. Er wollte, dass der Nutzen seiner Forschung der Allgemeinheit gehören sollte. Das führte zu einer schnellen und weiten Verbreitung seines Durchleuchtungsverfahrens und zu grundlegender Umwälzung in der Medizin. Jetzt konnten erstmals Bilder von Knochen oder inneren Organen auf Fotofilm angefertigt werden. Schon bevor Röntgen 1901 den ersten Nobelpreis für Physik erhielt, wurde seine Methode an vielen Orten angewendet.
So auch 1897 im ersten Chemnitzer Röntgeninstitut von Dr. Walther und 1898 im ersten Chemnitzer Stadtkrankenhaus an der Zschopauer Straße. Die Firma Max Kohl in Chemnitz stellte Röntgenröhren her, die sich allerdings nur große Einrichtungen in Städten mit entsprechender Finanzkraft leisten konnten. Limbach gehörte nicht dazu. Es hatte um 1900 reichlich 12.000 Einwohner. Aber es gab hier an der Bürgerschule I einen sehr interessierten und rührigen Lehrer - Arthur Müller. Er war am 31. Oktober 1868 in Oberfrohna geboren worden und hatte als Kind selbst diese Schule besucht. Nach Limbach kam der dreißigjährige Lehrer zu Schuljahresbeginn an Michaelis, 29. September 1898. Müller unterrichtete auch an der Fortbildungsschule (Vorgängerin der Berufsschule) und am Limbacher Technikum, das 1898 bis 1908 in der Anna-Esche-Straße 10 bestand. Der Lehrer kaufte sich eine der kostspieligen Röntgenröhren und experimentierte damit bei seinen Physik-Vorlesungen am Technikum. Die Möglichkeiten der Röntgendurchleuchtung faszinierten ihn so, dass er an Hochschul-Lehrgängen zum Thema Röntgenstrahlen und deren Anwendungen teilnahm und sich so immer mehr Kenntnisse und Erfahrungen aneignete.
Schließlich richtete er 1902 in seinem Haus in der Kirchstraße 2 ein „Privatlaboratorium für Röntgenstrahlen“ ein. Bereits 1905 konnte er sein voll funktionsfähiges Röntgenlabor der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Müller wollte, wie sein verehrtes Vorbild Röntgen, den Nutzen der neuen Methode allen zugänglich machen. Bis dahin schickten die Ärzte ihre Patienten zu Röntgenuntersuchungen nach Chemnitz, falls sie das überhaupt für nötig hielten. Jetzt stellten Ärzte aus dem Ort und der Umgebung ihre Patienten dem „Röntgen-Müller“ zur Untersuchung vor. Der Lehrer hatte an den schulfreien Nachmittagen und am Wochenende ein volles Wartezimmer. Es kamen Ärzte mit Patienten im Auto oder Sanitätswagen und wollten Knochenbrüche geröntgt haben, Fremdkörper entfernen, bei ihren Patienten Verletzungen einrenken und Verbände anlegen. Während des 1. Weltkrieges kamen auch Verwundete aus umliegenden Lazaretten zum Röntgen. So bot das Müllersche Privatlabor über zwanzig Jahre lang die einzige Möglichkeit zu einer Röntgen-Untersuchung weit und breit.
In dieser Zeit spielte die Volksseuche Tuberkulose eine große Rolle. Etwa drei Prozent der Bevölkerung starben damals jährlich an dieser Krankheit, wozu auch Unterernährung und Hygienemängel maßgeblich beitrugen. Robert Koch hatte 1882 das Tuberkelbakterium als Erreger entdeckt, aber erst 1926 wurde ein Impfstoff durch die Franzosen Calmett und Guérin (BCG-Impfung) gefunden. Als wirksames Medikament fanden die Amerikaner Waksman, Schatz und Bugie (New Jersey) 1943 das Antibiotikum Streptomycin. Bis dahin mussten gute Ernährung und die „alten Zauberkräfte der Natur: Sonne, Luft und Licht“ (Sauerbruch) gegen die Tuberkulose helfen. Zu einem enormen Ansteigen der Erkrankungszahlen kam es wieder nach 1945, überall mussten „Lungenheilstätten“ eingerichtet werden, in öffentlichen Gebäuden waren Spucknäpfe angebracht und Schilder mit der Aufschrift „Nicht auf den Boden spucken!“ Die Röntgenreihenuntersuchung zur Erkennung der Tuberkulose stammt von 1939. Sie wurde nach Befehl Nr. 234 der SMAD 1947 Grundlage für die systematische Untersuchung der Bevölkerung (VRRU) der DDR, bei der ab 1956 einmal im Jahr die Lunge jedes Erwachsenen geröntgt wurde. Bis 1960 wurden 11 Millionen Lungen-Aufnahmen durch die Röntgen-Busse angefertigt. Diese Vorsorge hat viel zur Früherkennung der Lungentuberkulose, aber auch des Lungenkrebses beigetragen.
In welchem Ausmaße die Krankheit sich im Leben der Städte und Gemeinden auswirkte, lässt sich daran ablesen, dass die Kommunen Ausschüsse bildeten, die nach Möglichkeiten suchten, die Seuche einzudämmen. Der Lehrer Arthur Müller setzte sich bald sehr intensiv für die Lungenkranken ein. 1914 wurde er zum Vorsitzenden des städtischen „Ausschusses zur Bekämpfung der Tuberkulose“ gewählt. Hier betätigte sich der hilfsbereite Lehrer uneigennützig zum Wohle der Allgemeinheit. Er konnte durch seine Röntgenaufnahmen der Lunge die Krankheit feststellen und Verschickungen zur Kur anregen. 1922 wurde Müller zum Oberlehrer ernannt. Im Volksmund hieß er nur noch respektvoll und anerkennend der „Röntgen-Müller“. Sein Laboratorium reichte bald nicht mehr aus, so dass die Stadt Limbach/Sa. 1924 für den Lehrer ein Geschäftszimmer mit vollständigem Bestrahlungsraum zur Verfügung stellte.
Auf seine Veranlassung richtete die Stadt eine Walderholungsstätte im Hohen Hain ein für bedürftige, unterernährte, „lungengefährdete“ Kinder. Die Eröffnung war am 7. August 1924, und sie hat Tausenden Kindern bei einem jeweils vier- bis sechswöchigen Aufenthalt mit guter Verpflegung im Wald nahe der Knaumühle geholfen, ihre Gesundheit zu stabilisieren. Dass dies bitter nötig war, zeigt die Untersuchung des Schularztes Dr. Georg Neideck 1922, der 70 Prozent der Kinder untergewichtig und 40 Prozent als „lungengefährdet“ befand. Eine Oberfrohnaer Walderholungsstätte befand sich im Gemeindewald.
Im Schuldienst arbeitete der Oberlehrer Müller bis zum Herbst 1933 und trat dann, 65 Jahre alt, in den wohlverdienten Ruhestand. Erst 1936 legte er seine öffentlich-ehrenamtliche Tätigkeit für die Gesundheit der Limbacher aus Altersgründen nieder. Er wurde öffentlich mit Dank und Anerkennung bedacht. Müller starb am 21. Mai 1938 im Alter von fast 70 Jahren. Ein Nachruf im Limbacher Tageblatt nannte ihn einen „edlen Betreuer der Volksgesundheit“ und versprach bleibendes, dankbares Andenken. Heute ist er vergessen.
Aus dem Heft von Hermann Schnurrbusch
„Personen und Persönlichkeiten“, Limbach-Oberfrohna 2006
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 18. Februar 2021 -
Gert Hofmann zum 90. Geburtstag
Gert Hofmann zum 90. Geburtstag
Gert Hofmann, einer der meistübersetzten deutschen Dichter der 1970 bis 1990er Jahre, wurde am 29. Januar 1931 in Limbach, einem Ortsteil des heutigen Limbach-Oberfrohna, geboren. Die Sprachmelodie seiner Heimat prägte den Weltbürger Gert Hofmann bis an sein Lebensende. In seiner Dissertation plädierte er für die »Dramatisierung des Romans« in Anlehnung an Henry James und Thomas Mann. In der Novelle »Die Rückkehr des verlorenen Jakob Michael Reinhold Lenz nach Riga« wird Hofmanns herausragende Leistung als deutscher und europäischer Dichter und Erzähler eindrucksvoll deutlich.
Das Geburtsjahr Gert Hofmanns liegt am Ende einer beispiellosen Entwicklung der sächsischen Industrie. Bereits im 18. Jahrhundert exportierten Limbacher Unternehmer Strümpfe und Handschuhe in alle Welt. Zwischen 1830 und 1930 verzehnfachten sich die Bevölkerungszahlen in Sachsen. Aus ganz Europa und Deutschland kamen Menschen, um hier Arbeit zu finden. Chemnitz und die Kleinstädte seiner Umgebung verschmolzen zu einer gigantischen Fabrik. Die Stadtsilhouetten wurden von hunderten Industrieschornsteinen geprägt. Selbst noch in Hinterhäusern wirkte man an der textilen Produktion. Die Maschinen entstanden gleich nebenan, in der Nachbarfabrik. Mit den Jahren bestimmte der Rhythmus der Industrie das gesamte Leben der Städte und Dörfer. Morgens strömten tausende und abertausende Menschen in die Fabriken. In den 1920er Jahren verdrängte eine internationale Massenkultur die bürgerlich-paternalistischen Kultur des 18. Und 19. Jahrhunderts. Fremdsprachenkenntnisse wurden für die Geschäftskommunikation unumgänglich. Im 1927 eröffnete Limbacher Apollo-Kino saßen Fabrikanten und Fabrikarbeiter nebeneinander und sahen sich Filme aus Babelsberg oder Hollywood an.
Gert Hofmann war nicht der einzige bedeutende Literat seiner Generation, der aus dieser Region hervorging. Vier Jahre vor ihm wurde in Limbach Werner Mittenzwei (1927–2014) geboren. Der in Eppendorf geborene Heiner Müller (1929–1995) verbrachte einige Jugendjahre in Bräunsdorf (heute Ortsteil von Limbach-Oberfrohna). Der in Chemnitz geborene Peter Härtling (1933–2017) lebte einige Jahre mit seinen Eltern im nahen Hartmannsdorf.
Gert Hofmann wurde 1931 in einem Haus an der Limbacher Kreuzstraße (heute Paul-Seydel-Straße) geboren. Gegenüber befindet sich noch heute eine Konditorei, in der sein Onkel eines der ersten Limbacher Stummfilmkinos betrieb, ehe er das Apollo-Kino erbaute. Gegenüber der Konditorei liegt die Gaststätte „Stadt Wien“. Hier waren die Großeltern Hofmanns Stammgäste. Die Großmutter stammte aus Wien. Seine Eltern hatten sich getrennt, den Vater lernte er nicht kennen. Mit der Besetzung Limbachs durch Angehörige der 3. US-Armee am 14. April 1945 endete die Kindheit Gert Hofmanns. In den Wirren der Nachkriegszeit inhaftierte die spätere sowjetische Besatzungsmacht den Jugendlichen Gert Hofmann für einige Tage und anschließend wurde er von der Schule verwiesen. Jedoch gelang ihm trotzdem die Aufnahme in die renommierte Leipziger Fremdsprachschule. Dort legte er gleichzeitig die Übersetzter- und Dolmetscher-Prüfungen in Englisch und Russisch ab. Die normalen Schüler hatten schon mit einer Sprache Mühe. Hofmann galt als Genie. Nach dem Abitur nahm er in Leipzig ein Studium auf. Berühmte Hochschullehrer unterrichteten damals an der Leipziger Universität. (Hofmann nennt: Frings, Korff und Krauss) Aber nach einem Jahr flüchtete Hofmann in den Südwesten der Bundesrepublik, nach Freiburg im Breisgau. Auch hier berühmte Namen der Hochschullehrer (Hofmann nennt: Bergstraesser, Heidegger und Heuer). Nach dem Studienabschluss formulierte Hofmann innerhalb weniger Wochen sein literarisches Selbstverständnis als Dissertationsschrift unter dem lapidaren Titel „Interpretationsprobleme bei Henry James“. Mit Henry James und Thomas Mann geht Hofmann davon aus, dass es nicht mehr möglich ist, einen Roman im klassischen, epischen Sinne zu schreiben. Er zitiert Thomas Mann: „Heute wird alles als Roman bezeichnet, was garantiert keiner ist.“ Die Dramatisierung des Romans zeigt den Ausweg. Mit der Korrektur der bloß beschreibenden Epik verbunden ist der Verzicht auf Aktualismus. Der Künstler solle sich ein Sujet aus der jüngsten Vergangenheit suchen, was nicht mehr existiert, an das sich die Leser jedoch noch erinnern. Folgerichtig lehnt Hofmann das autobiographische Gehabe konsequent ab. Die Struktur seiner Werke wird von Dialogen gestiftet. Die Mehrdeutigkeit der Sprache soll beim Leser Assoziationen befördern. Der Schriftsteller ist ein Sprachschöpfer. Das Motto des Erzählens lautet: Es hätte so gewesen sein können!
Über viele Jahre wagte Hofmann selbst keinen Prosatext zu veröffentlichen. Er konzentrierte sich auf Hörstücke, Hörspiele, Fernsehspiele und Theaterstücke. In den Jahren 1960 bis 1992 wurden 43 Hörspiele Gert Hofmanns von deutschen und internationalen Radiosendern z.T. mehrfach produziert und gesendet, sieben Theaterstücke aufgeführt und vier Fernsehspiele gesendet. Gert Hofmanns Theaterstücke wurden u.a. von Helmut Qualtinger und Ivan Nagel inszeniert.
Erst Ende der 1970er Jahre wandte sich Hofmann Romanen und Erzählungen zu. Die Legende sagt, dass ein Hörspiel Thomas Bernhardts im Autoradio der Anlass gewesen sein soll. Innerhalb von 14 Jahren verfasste Hofmann in ungeheurer Arbeitsintensität sein Prosawerk. In Interviews sagte er, dass er einen Zwang spüre, bestimmte Dinge aufschreiben zu müssen, zum Teil fühle er sich „wie gehetzt“.
Nach Gert Hofmanns Worten sind Kindheit und Jugend Voraussetzungen für das Schaffen eines Schriftstellers, doch erwartet der Leser vergeblich auf einen „Heimatroman“ aus seiner Feder. Im Gegenteil. Er entwickelte im Roman „Der Kinoerzähler“ sehr glaubhaft, aus der Sicht des Enkels, eine Fiktion, wonach sein Großvater der Stummfilm-Kinoerzähler des Limbacher Apollo-Kinos gewesen sei. Doch im Geburtsjahr Gert Hofmanns war das Apollo-Kino bereits auf den Tonfilm umgestellt. Einen Kinoerzähler mit dem Namen Karl Hofmann gab es aber auch vorher nicht. Bezeichnend ist, dass Hofmann selbst in dieser Fiktion Straßen- und Ortsnamen aus Limbach und Umgebung verfremdet. In der Erzählung „unsere Eroberung“, „Das Glück“, „Veilchenfeld“ und „Die Denunziation“ wird in dieser Weise immer wieder auf die Stadt L. (Limbach) angespielt.
Die Verwurzelung in der der deutschsprachigen literarischen Erbschaft geht bei Hofmann mit der aktiven Aneignung des europäischen Erbes einher. Bereits als Student in Leipzig las er russische, französische und englische Klassiker im Original. Hofmann ging davon aus, dass künstlerische Individualität nur dem möglich ist, der sich seine kulturelle Erbschaft aneignet.
In den Novellen kommen Hofmanns Stärken am deutlichsten zum Ausdruck. In der „Die Rückkehr des verlorenen Jakob Michael Reinhold Lenz nach Riga“ behandelt Hofmann, anders als Georg Büchner, der in seiner berühmten Novelle „Lenz“ die Wanderschaft des Dichteres thematisierte, in zwölf kurzen Kapiteln nur einen Tag im Leben des Lenz: den 23. Juli 1779. An diesem Tag kehrte Lenz nach elfjähriger Abwesenheit in seine Geburtsstadt Riga und in sein Vaterhaus zurück. Doch hier beginnt die Verstörung. Der Vater, der eben zum Generalsuperintendent von Liveland gewählt worden war, will gerade das alte „Vaterhaus“ verlassen und in ein neues Haus, „eigentlich ist es ein Palast“, ziehen. Lenzens Mutter verstarb in der Zeit seiner Abwesenheit. Der Vater hat eine neue Frau. Anders als in der biblischen Geschichte wird der „verlorene“ Sohn vom Vater jedoch nicht freudig empfangen. Im Gegenteil. Er antwortet dem Sohn nicht einmal auf seine zahlreichen Anreden. Es bleibt daher nur ein Monolog des Sohnes. Schließlich gipfelt die Novelle im 6. Kapitel in Lenzens Ruf an den Vater: „Verzeihen Sie, es fehlt hier ein Gedanke, es fehlt hier ein Wort. Ich saß auf dem Stein und … ich saß auf dem Stein …. jetzt ist es fort, das Wort! Schauen Sie, es ist zwar nur ein Wort, aber trotzdem! Wo ist es denn hin, das Wort? Haben Sie das Wort vielleicht? Herr Vater, bitte geben Sie mir das Wort zurück, ich will Ihnen auch dankbar sein. Sie haben das Wort doch? Was machen sie denn mit dem Wort? Wo haben Sie denn das Wort?“
Die Formulierung erinnert an den berühmten Beginn des Johannis-Evangeliums: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ Hofmann macht deutlich, dass Lenz die Sprache zur Selbstbehauptung gegenüber dem übermächtigen Vater und gegenüber den Zumutungen des Lebens dient. Die Monologe Lenzens sind ein Meisterstück Hofmanns. Er vermag die paranoide Befangenheit mit der erstaunlichen Klarsicht seines Helden, der die »widernatürlichen Lebensverhältnisse« des gleichzeitig fast ehrfürchtig respektierten Vaters erfasst, in einer verstörenden Weise darzustellen. Lenz durchschaut die Anmaßung des protestantischen Geistlichen, der sich als Gott wähnt, der auf die Gemeinde „herabpredigt“. Aber Hofmanns Sprache ist frei von jeglichem „Moralisieren“. Für viele Leser verstörend bleibt jedoch, dass Hofmanns Sprachvermögen Assoziationen zu ihren eigenen Verfehlungen, Fehlleistungen und Versagen freisetzt. Doch Hofmann verfügt über das Selbstbewusstsein einer sanften Vernunft, die keine Sieger kennt, die deshalb auch keiner „Verurteilungen“ bedarf. Mit Recht rühmen Michael Hamburger, Christopher Middleton und Klaus Walther diesen, in der deutschsprachigen Literatur singulären Stil Gert Hofmanns.
Eine junge Generation wird Gert Hofmanns Werk neu entdecken. In seiner Geburtsstadt wird, auf Beschluss des Stadtrates, der Stadtbibliothek am 29. Januar 2021, anlässlich des 90. Geburtstages Gert Hofmanns, der Name Stadtbibliothek „Gert Hofmann“ verliehen.
Andreas Eichler
Mehr dazu: https://www.mironde.com/litterata/9174/essay/gert-hofmann-zum-90
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 4. Februar 2021 -
Die letzten Rußdorfer Jahre
Warum ich so gern vom alten Rußdorf berichte, das hat natürlich seinen Grund. Die vergangen Zeiten stehen doch wohl mehr oder weniger bei allen älteren Menschen im Vordergrund, wenn sie auch nicht so goldig waren, wie sie immer dargestellt werden. Das Erinnern an die Jugendzeit ist fest verwurzelt im Hirn eines jeden. Besonders schön war und ist der Zusammenhalt im Dorf. Jeder kennt jeden, man spricht gern miteinander, und kriminelle Probleme gab es früher überhaupt nicht. Besondere Vorkommnisse verbreiteten sich wie ein Lauffeuer durch das Dorf. Dabei wurden stets die ortsüblichen Spitznamen und Straßennamen verwandt. Man sprach von der Schlaz (Anteil Falken), von der Sperlingsgasse (Sonnenstraße), von der Sackgasse (Kurze Straße), vom Kuwer und vom Sauran (südlicher und nördlicher Teil der Meinsdorfer Straße) und von der Huhle (eine ehemalige Hohlgasse, jetzt die Hohe Straße).
Die Folgenstraße mit ihren Randsiedlungshäusern war die Ziegenschweiz, während die Langenberger Straße nach wie vor die Färbergasse ist, weil dort in der Entwicklungszeit der Textilindustrie die Färber wohnten. Das ehemalige Bauerndorf mit seinen ca. 50 Bauern und Landwirten versuchte mit allen Mitteln, sich vom „Ausland“ unabhängig zu machen, was wohl auch mehr oder weniger gelang. So gab es zu den Zeiten um den Ersten Weltkrieg herum in Rußdorf 90 Handwerkerfamilien bis hin zum Brunnenbauer und Bürstenmacher. Insgesamt konnte man wohl an die 180 Geschäfte zählen, und das bei ca. 400 Wohnhäusern mit etwa 3500 Einwohnern. 12 Gaststätten luden zur Einkehr ein. Außerdem gab es etwa 30 Betriebe der verschiedensten Größe (von der Strumpffabrik Welker & Söhne über verschiedene Wirkwarenfabriken bis hin zur Senffabrik des Ferdinand Sommer). Alles war vorhanden. Steinbruch und Ziegelei sowie zwei Bauunternehmer sorgten für Neu-, Um- und Ausbau. Die Gesundheit lag in der Hand des Dr. med. Brummer, außerdem sorgten eine Apotheke, ein Heilpraktiker und ein Zahnarzt für das Wohl der Rußdorfer. Auf kulturellem Gebiet waren Kunstmaler, ein Geigenvirtuose, Ritschers Marionettentheater, zwei Gesangsvereine, das Mandolinenorchester und der Zitherklub tätig. Außerdem gab es weitere Vereine, damit jeder seinem Hobby nachgehen konnte. Die zwei Sportvereine boten immer wieder Veranstaltungen an, der Schützenverein war aktiv mit seinem Vogelschießen und der Pfeifenclub versuchte Rekorde im Langzeitrauchen.
Die Rußdorfer Sportler hatten schon immer einen guten Namen.
Hans Lange
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 21. Januar 2021 -
Hausbau im 18. Jahrhundert
Die Häuschen am Helens- und am Dorotheenberg waren alle nach dem gleichen Bauplan und Muster höchst einfach, aber solide gebaut. Das Erdgeschoss wurde auf einer Grundfläche von etwa 6 x 12 m aus Bruchsteinen oder Lehmziegeln etwa 5 bis 6 Ellen[1] hoch errichtet. Darauf kam hölzernes Fachwerk etwa in der gleichen Höhe, die Fächer wurden mit Lehm ausgefüllt. Das Satteldach mit hohen Giebeln war mit Schiefern, oft auch mit Stroh oder Schindeln gedeckt.
Die Haustür in der Mitte des Gebäudes führte vom Vorgarten oder direkt von der Straße in einen schmalen Flur mit einer halsbrecherisch schmalen und steilen Holztreppe ins Obergeschoss. Die Tür und die Fenster im Untergeschoss hatten manchmal Gewände aus Chemnitzer Porphyrtuff, im Obergeschoss fasste Holz die kleinen Fenster ein.
„Duck dich!“ hieß es beim Eintritt in das Haus und „Bück dich!“ auch bei den Türen und Fenstern im Inneren. Die Deckenhöhe betrug kaum zwei Meter. Zur Wohnung einer Familie gehörten eine Wohnstube und eine Schlafkammer, dazu eine Bodenkammer und die Mitbenutzung des Dachbodens. Im Wohnstübchen drängte sich die zahlreiche Familie um den Ofen aus Peniger oder Waldenburger Kacheln. Neben den Großeltern sicherten sich oft die Verkäufer eines Hauses freie Wohnung in der Stube des Käufers. Neben den einfachen Möbeln mussten der Strumpfwirkerstuhl, das Spulrad und alle anderen notwendigen Handwerksgeräte untergebracht werden.
Im Vorgarten und hinter dem Haus war Platz zum Anpflanzen von Obst, Gemüse oder Kartoffeln, auch um Kleintiere zu halten. Das trug zur Selbst-versorgung der Bewohner bei.
Einige dieser Strumpfwirkerhäuschen existieren noch auf der Helenen- und der Doro-theenstraße. Die meisten sind verschwunden.
Aus P. Fritzsching, H. Schnurrbusch: Vom Urwalddorf zur Industriestadt, Limbach-Oberfrohna 2007
Dr. Hermann Schnurrbusch
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 21. Januar 2021 -
Paul Fritzsching
Wer war dieser Mann, dessen Name heute in Limbach-Oberfrohna ein Platz und eine Straße tragen? Er muss also für unseren Ort schon eine gewisse Bedeutung haben. Die zum Teil vorhandene Unwissenheit der jungen Generation um Vorgeschichte oder Persönlichkeiten ihrer Heimat hat sicherlich sehr verschiedene Ursachen, auf die ich in diesem Beitrag nicht näher eingehen möchte.
Am 12. Dezember 1861 erblickte Paul Fritzsching in der kleinen Stadt Meerane das Licht der Welt. Nach erfolgreichem Abschluss seiner Schulzeit besuchte er von 1875 bis 1881 das damalige Lehrerseminar in Zschopau. Danach arbeitete er zuerst als Hilfslehrer und ab 1884 als ständiger Lehrer in Niederwürschnitz (heute: Erzgebirgskreis). Ein Jahr später geht er nach Limbach an die Bürgerschule I (heute: Goethe-Grundschule). Hier kam es zu ersten Kontakten mit Paul Seydel, einem Lehrer der sich um die Geschichtsschreibung im Limbacher Land große Verdienste erworben hat. Die Beiden verband zeitlebens eine enge Freundschaft. Viele gemeinsame Arbeiten legen davon Zeugnis ab. Beide wechselten 1888 an die damals neu erbaute Bürgerschule II (heute Pestalozzi-Oberschule). Paul Fritzsching bekleidete viele Ehrenämter. Er war Stadtrat und Mitarbeiter in anderen städtischen Gremien aber auch im Bezirkslehrerverein oder im Verein für sächsische Volkskunde. Im Jahre 1958 schrieb sein Sohn Karl: „Beide (gemeint sind P. Fritzsching und P. Seydel) waren Lehrer, Jünger Pestalozzis, also auch Verfechter seiner These, dass die Anschauung das Fundament aller Erkenntnis ist. Wo aber die Gegenwart mit ihrer Anschauung versagt, soll das Heimatmuseum … die Lücken schließen“. Der Gedanke zu einer ortsgeschichtlichen Sammlung wurde von Seydel schon 1806 in die Tat umgesetzt. Zuerst in den Kellerräumen der Bürgerschule II und später unter P. Fritzschings Regie in der ehemaligen Wirkschule, Turnstraße 4 (heute: Hort Der Goethe-Grundschule / Zeichnung). 1905 wurde P. Fritzsching zum Oberlehrer ernannt und im Jahre 1908 zum stellvertretenden Direktor der Bürgerschule II. Schon 1924 musste er infolge des sogenannten „Personalabbaugesetzes“ mit 63 Jahren in den Ruhestand gehen. Am 27. Februar des gleichen Jahres war sein langjähriger Freund Paul Seydel gestorben. Paul Fritzsching übernahm nach seiner Pensionierung die Leitung des Heimatmuseums und baute es weiter aus. Auf regionalgeschichtlichem Gebiet zeigte Fritzsching überdurchschnittliche Aktivitäten. Viele seiner Aufsätze wurden in der Presse veröffentlicht, oder erschienen in Buchform. Bis zu seinem Tode im Jahre 1947 sind es weit über einhundert Arbeiten. Fritzschings Grundanliegen bestand darin, einer breiten Bevölkerungsgruppe Heimatgeschichte verständlich nahe zu bringen. Am 12. Dezember 1941 beging der von vielen Zeitgenossen geachtete Lehrer und Heimatforscher seinen 80sten Geburtstag. Ihm wurden viele Ehrungen zuteil. Auch nach Ende des Krieges scheute er keine Mühen und ging im März 1946 zusammen mit Sohn Karl und Hausmeister Dohle daran, das Museum in den Kellerräumen der Pestalozzischule wieder für die Öffentlichkeit herzurichten. Durch die Einrichtung eines Kriegslazaretts im Schulgbäude, hatten einige Ausstellungsstücke großen Schaden genommen. Im Oktober 1947 schrieb Paul Fritzsching seine letzte regionalgeschichtliche Abhandlung über die Entstehung des Johannisplatzes. Der Artikel erschien im gleichen Jahr in der „Volksstimme“ (heute: „Freie Presse“). Da der Aufsatz von der Redaktion so gekürzt wurde, „dass er stark an Verständnis für die Allgemeinheit… verloren hat“, brachte Fritzsching seinen Unmut darüber öffentlich zum Ausdruck. Das gleiche Blatt veröffentlichte am 2. Dezember 1947 folgende Zeilen: „Kurz vor Vollendung seines 86. Lebensjahres verstarb am 27. November 1947 Oberlehrer i.R. Paul Fritzsching. Mit ihm verschied einer der verdienstvollsten Bürger der Stadt Limbach. Er hat sich um die Erforschung der Geschichte unserer Stadt und der engeren Heimat einen Namen gemacht. Dem Heimatmuseum, dem er jahrzehntelang in unermüdlicher Schaffenskraft vorgestanden hat, gab er seine Bedeutung.“
Auf dem Limbacher Friedhof hat Fritzsching in der Familiengrabstätte seine letzte Ruhe gefunden. Seit einigen Jahren kümmern sich Schüler der Pestalozzi-Oberschule, im Rahmen eines Projektes um die Pflege und den Erhalt der Grabstätte. Vielleicht könnten diese Aktivitäten auch Ansporn für weitere Grabpatenschaften sein, bei denen eine Unterstützung durch die Denkmalpflege wünschenswert wäre. Die Erhaltung der letzten noch bestehenden Grabstätten bekannter Persönlichkeiten liegt sicher auch im Interesse unserer Stadtväter.
Text und Zeichnung: Volker Bokum
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 7. Januar 2021 -
Denkwürdige Bäume im Limbacher Land
In den Jahren des 19. Jahrhunderts wurden aus verschiedenen Anlässen, jeweils verbunden mit patriotischen oder religiösen Feierlichkeiten, denkwürdige Bäume meist Eichen und Linden gepflanzt. Die Eichen z.B. sind nicht nur in Deutschland Symbol der Kraft und der Beständigkeit. Diese Bäume sind heute teilweise noch erhalten.
Limbach: Im Jahre 1839 pflanzte man feierlich auf dem dritten Limbacher Friedhof, heute das Gelände hinter der Großsporthalle, zwei Eichen in Gedenken an 300 Jahre Reformation und an einen sächsischen Kurfürsten, der die Reformation förderte. Rechts vom Friedhofstor die sog. Heinrichseiche (Heinrich der Fromme, Markgraf von Meißen 1573-1541) sie steht unmittelbar neben der heutigen Großsporthalle und nahe dem Anna-Esche Gässchen und ist angeblich noch erhalten. Links die Luthereiche. Einer der Bäume ist nicht mehr existent, wahrscheinlich ist das die Luthereiche. Die noch stehende Eiche weist einen Stammumfang von lediglich 2,80 m aus. Zwischen Stammumfang und Alter besteht immer ein ursächlicher Zusammenhang. Mit Sicherheit ist es nicht mehr der Baum von 1839. Jedem wird es einleuchten, dass Bäume mit ihrem Wurzelwerk auf einem Friedhof im Wege sind. So ist die ursprüngliche Heinrichseiche wohl lediglich eine Legende. Der heutige Baum ist eine Nachpflanzung und höchstens 100 Jahre alt. Vor der Bürgerschule, heute die Gotheschule, setzte man 1888 bei der Einweihung, verbunden mit obligatorischen Feierlichkeiten, ebenfalls eine sog. Friedens-Linde, die aber gleichfalls heute nicht mehr steht. Im Stadtpark stand eine 1894 gepflanzte Eiche, die an die Gründung des Stadtparkes erinnert. Sie ist nicht mehr vorhanden, an der Stelle steht jetzt ein wesentlich jüngerer Baum. Gerade nach dem ersten Weltkrieg holzte die frierende Bevölkerung massenhaft Bäume auch im Stadtpark ab. Kaiser Wilhelm hatte sich 1918 aus dem Staub gemacht, sein frierendes Volk war ihm jetzt egal. So sind die heute vorhandenen Laubbäume im Stadtpark alle neueren Datums, und höchstens 100 Jahre alt. Die Luthereiche am nördlichen Eingang, Stammumfang 3,20 m, wurde 1917 gepflanzt und erinnerte an 400 Jahre Reformation. Der jüngste Baum, eine Winterlinde, wurde 2016 mit einer kleinen Feier von Naturfreunden, den Grünen und der Stadtgärtnerin am Mittelweg des Stadtparkes gepflanzt.
Oberfrohna: So wurden in der Zeit des Patriotismus auch mehrere Eichen auf dem alten Friedhof Oberfrohna neben der heutigen Lutherkirche in die Erde gesetzt, das geschah ab 1871. Nach dem Sieg von 1871 der deutschen Staaten über den französischen Erbfeind schlugen die nationalistischen Wogen besonders hoch. Man fand viele Anlässe, um bei jeder passenden Gelegenheit Gedenkbäume zu pflanzen. Ein Baum, eine amerikanische Eiche oder Roteiche, die an der oberen Ecke des Kirchgrundstückes steht, scheint ca. 170 Jahre alt zu sein. Sie ist auch der mächtigste und prächtigste Baum an der Lutherkirche. Man muss bedenken, dass ein Baum im Jahr und im Umfang um ca 1 cm zulegt, damit kann man ungefähr auf das Alter des Gewächses schließen. Der Stammumfang dieser Eiche beträgt respektable 6,20 Meter. Weitere 5 Eichen stehen auf dem ehemaligen Friedhofsgelände und sind ca. 100 bis 120 Jahre alt. Die stärkste Eiche weist 3,40 m Stammumfang auf. Diese Bäume sind an den jeweiligen Standorten, den damaligen feierlichen Anlässen der Pflanzung, heute nicht mehr genau zuzuordnen. Man pflanzte auch später, aus Anlass des Sieges über Frankreich, patriotisch „mit Pauken und Trompeten“ eine weitere Eiche – die heute mächtige Bismarckeiche neben der Oberfrohnaer Gerhard-Hauptmann-Schule, die seit der Pflanzung 1885 zu einem mächtigen Baum und Naturdenkmal heranwuchs. Hier weiß man genau, dass dies der damalig gepflanzte Baum ist. Die Eiche an der Schule erreicht einen Stammumfang von 4,20 Meter. Jede dieser Pflanzungen wurde mit einer patriotischen Feier verbunden, zugleich einem Volksfest.
Niederfrohna: Dann gibt es im nahen Mittelfrohna an der Hauptstraße noch einen weiteren denkwürdigen Baum, die sog. Friedenseiche, gepflanzt ab ca 1900. Auch sie wurde als Naturdenkmal mit einem Eulenschild versehen. Ganz unten in Niederfrohna an der Kirchenmauer haben wir eine weitere sehr starke Eiche mit 4,50 m Stammumfang. Der stärkste Baum in Niederfrohna ist eine Weide, die hinter dem Teppichfreund am Ufer des Frohnbaches steht.
Sonstige Bemerkungen zum Stadtgrün: Ein neues Phänomen an unseren alten Laubbäumen ist der sog. „Grünastbruch“ – das ist allerdings sehr selten. Starke Äste brechen manchmal im belaubten Zustand, auch bei Windstille ohne Vorwarnung ab. Eine gesonderte Theorie wurde dazu entwickelt. Leicht kann damit eine neue Hysterie entstehen. Beruhigend ist, im Limbacher Land gibt es seit langer Zeit keine Verletzungen von Menschen oder gar Todesfälle durch umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste. Heute besitzen wir im Limbacher Land 9 Laubbäume mit über 5 Meter Stammumfang, eine Roteiche mit über 6 Meter und eine Buche mit über 7 Meter Umfang. Wir besitzen damit mehr starke Laubbäume, wie die Stadt Chemnitz. Unsere alten und besonders die ortsbildprägenden Laubbäume sind quasi das Tafelsilber der Bürger und müssen um jeden Preis erhalten werden.
Friedemann Maisch
Quelle: Gemeindebuch-Oberfrohna 1839, Notizen von Paul Fritsching
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 26. November 2020 -
Turnen
Die Turnbewegung in Deutschland ist 1807 von ‚Turnvater‘ Friedrich Ludwig Jahn und Friedrich Friesen ins Leben gerufen worden. Während Jahn zu den schon bekannten weitere Turngeräte hinzusetzte wie Barren oder Reck und die „geistige Formung einer Nation“ anstrebte, war Friesens Bemühen besonders in Verbindung mit den studentischen Burschenschaften auf die Befreiung von der Napoleonischen Besetzung Europas gerichtet. Er kämpfte gemeinsam mit Schill, Lützow, Körner in den Befreiungskriegen und fiel 1814. Die nationale Ausrichtung des Turnens gegen die deutsche Vielstaaterei und demokratische Ziele führten 1820 bis 1842 zum Verbot, der „Turnsperre“ nach dem Wiener Kongress 1815 und den Karlsbader Beschlüssen 1819.
Zu einer Belebung des Turnens kam es, nachdem der König von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., die Aufhebung des Turnverbotes angeordnet hatte. 1846 gab es in Sachsen schon 61 Turnvereine. Auch in unserer Gegend erlebte das Turnen einen deutlichen Aufschwung, schon 1845 wurde der „Turnverein Limbach“ gegründet, der sich 1861 und nochmals 1895 eine eigene Turnhalle auf dem Turnplatz Weststraße 51 erbaute. Die Turnhalle wurde 1991 wegen Baufälligkeit abgerissen. Die Telekom baute auf dem Gelände eine Telefon-Vermittlungsstelle.
Der Verein war darum bemüht, mit den Nachbarvereinen Verbindung zu halten und bei gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. So fand 1846 in Waldenburg ein großes Turnfest mit mehr als 2000 Turnern – auch aus Limbach – statt, zu dem auch der Turnvater Jahn aus Freyburg gekommen war, zu Fuß! Das Turnen diente aber nicht nur der Körperertüchtigung, Turner sahen sich auch in der Pflicht, wenn es um die deutsche Einheit, die Verfassung und um demokratische Rechte ging. Die Februarrevolution in Frankreich von 1848 wirkte sich in Sachsen aus. Robert Blum in Leipzig leitete eine Protestbewegung. Von Hanau und Offenbach gingen Aufrufe aus, die Turner sollten sich zu bewaffneten Scharen vereinigen. Das führte zu Kontroversen in der Vereinsführung und Austritt von Mitgliedern. Limbacher (und andere) Turner kamen am „Volkstag“ am 5.4.1848 zur Demonstration vor das Waldenburger Schloss, das dabei in Flammen aufging. Ein meist aus Turnern bestehendes Freikorps unter dem Limbacher Karl Weiß nahm im Mai 1849 an den Barrikadenkämpfen in Dresden teil wie auch Richard Wagner, Gottfried Semper u.a. für die liberale Reichsverfassung und Grundrechte des deutschen Volkes. Die Revolution wurde mithilfe preußischer Soldaten niedergeschlagen, die Protagonisten mussten ins Exil fliehen (Sallmann) oder kamen ins Zuchthaus (Weiß), der Turnverein Limbach wurde 1850 aufgelöst, 1857 als Allgemeiner Turnverein Limbach wieder gegründet.
Ein weiterer Verein wurde 1861 unter dem Namen „Turnverein Limbach“ ins Leben gerufen. Die Gründer waren aus dem bestehenden Allgemeinen Turnverein ausgetreten, weil sie mit dessen Verfassung nicht mehr einverstanden waren. Bereits ein Vierteljahr nach der Gründung formierte sich eine Turnerfeuerwehr, aus der 1873 die allgemeine Freiwillige Feuerwehr hervorging. Der neue Verein zählte bereits 1863 sieben Riegen und 1876 hundert Mitglieder. Er kaufte nach erfolglosen Versuchen 1908 ein Grundstück an der Feldstraße (Einsteinstr.) 36 A und errichtete1909 eine zweigeschossige Turnhalle mit Sitzungszimmer (später Gaststätte „Turnerklause“), zwei Wohnungen und einem großen Turnsaal, Umkleide- und Sanitärräumen. Die Turnhalle wurde 2003 abgerissen und auf dem anschließendem Turnplatz Einfamilienhäuser errichtet.
Noch andere Turnvereine gründete sich 1862 in Oberfrohna und 1863 in Rußdorf. Der Oberfrohnaer turnte zunächst auf den Grundstücken Wolkenburger Straße 4, dann 6, kaufte 1887 vom Besitzer des Gasthofs Rautenkranz eine Fläche von 2000 m² und errichtete dort 1889 eine Turnhalle und plante erfolglos 1927 eine neue, größere. 1928 kaufte der Verein weitere Grundstücke an der Garten- (Rußdorfer) Straße und erbaute mithilfe der Bevölkerung und ansässiger Fabrikanten für 250.000 RM 1929 das Jahnhaus und 1938 die Jahnkampfbahn. Das Jahnhaus wurde bis 2014 über mehrere Jahre für über zwei Millionen Euro generalsaniert und beherbergt den TV Oberfrohna mit Fußball und anderen Mannschaften.
Dr. Hermann Schnurrbusch
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 12. November 2020 -
Mord an der siebenjährigen Lydia Clara Voigt am 3. September 1881
Das Mädchen Lydia Clara Voigt wurde am 30. September 1874 geboren. Sie war ein Waisenkind, ihre Eltern – der Vater Florian Gottfried Voigt, Handarbeiter in Kreuzeiche[1] und die Mutter Maria Anna geb. Gras - waren beide verstorben. Deshalb lebte das Mädchen bei ihrer Pflegemutter, der Handschuhnäherin Therese verw. Heinig in Mittelfrohna[2]. Die schickte die Siebenjährige wie immer sonnabends, am 3.9.1881 gegen 2 Uhr nachmittags, nach Limbach, um bei einem Strumpffabrikanten die fertige Ware abzuliefern und neues Material wieder mitzubringen. Gegen 4 Uhr hatte sich das Kind auf den Rückweg gemacht, kam aber bis 6 Uhr nicht zu Hause an. Die zur Suche ausgeschickte Tochter der Pflegemutter Heinig konnte Lydia nicht finden, nahm aber an, sie habe wegen des heftigen Regens bei anderen Verwandten Unterkunft gefunden.
Die Leiche des Kindes wurde erst am Sonntag, 4.9.1881 von den Strumpfwirkern Stopp und Richter aus Fichtigsthal früh halb 5 Uhr im Obstgarten des Rittergutes Mittelfrohna gefunden. Der Gemeindevorstand wurde informiert, erkannte das Kind und veranlasste eine ärztliche Untersuchung. Das Ergebnis der gerichtlichen Leichenschau und Leichenöffnung ergab, dass das Mädchen „in der gewaltthätigsten Weise gemissbraucht worden ist und hierdurch seinen Tod gefunden hat“.[3]
Es wurde eine Suche eingeleitet und Anwohner befragt. Dabei stellte sich heraus, dass die 11-jährige Ida Selma Pester aus Niederfrohna ebenfalls auf dem gleichen Weg nach Limbach geschickt und wieder nach Hause gekommen war. Dieses Mädchen war am Limbacher Schießhaus von einem unbekannten Mann angesprochen worden, der es veranlassen wollte, mit ihm ins Tal zu gehen. Dem habe die Ida sich widersetzt, aber beobachtet, dass sie die kleine Voigt überholt hätten. Der Mann mit brauner Jacke und blauer Schürze wurde bald als der 26-jährige Fleischergeselle Carl Theodor Türpe identifiziert. Weitere Zeugen fanden sich: Der Steinbrecher Landgraf hatte sich am Tattag mit Türpe am Schießhaus unterhalten, unterwegs hatte Türpe weitere Zeugen – Hartwig, Aurich und Kühnert – getroffen, die in seiner Nähe ein kleines Mädchen gesehen hatten. Andere Zeugen waren Türpe begegnet, ein Dienstmädchen hatte ihn in der Nähe des Leichen-Fundortes gesehen.
Türpe war 1856 in Mittelfrohna geboren, lernte nach seiner Konfirmation das Fleischerhandwerk, leistete 1876 bis 1878 seinen Militärdienst ab und wurde wegen schweren Einbruchsdiebstahls für 1 Jahr und 4 Monaten Zuchthaus verurteilt und erst im Frühjahr 1881 entlassen. Vor einer Festnahme floh er am 6.9.1881 nach Chemnitz, Augustusburg und Leubsdorf, wo ihn der Borstendorfer Gendarm Köhler in der „Uhlemannschen Restauration“ anhand des Steckbriefes und des auffällig angekohlten Spazierstockes erkannte und nach erneutem Fluchtversuch arretierte.
Türpe wurde nach Chemnitz gebracht. Ihm wurde am 10. Dezember vor dem Schwurgericht der Prozess gemacht. 63 Zeugen und 3 Sachverständige waren geladen, Türpe leugnete die Verbrechen bis zuletzt. Aber weitere Untaten wurde ihm nachgewiesen (Notzucht an einer 14-Jährigen aus Mainsdorf, versuchte Notzucht in Dörnthal, Raub bei Olbernhau).
Wegen des Mittelfrohnaer Mordes wurde Türpe zum Tode verurteilt, wegen der anderen Verbrechen zu 15 Jahren Zuchthaus und Ehrverlust. Der Chemnitzer Rechtsanwalt Koch forderte zur Unterzeichnung einer Petition an den König auf, dass das Todesurteil „wegen der Scheußlichkeit des Verbrechens“ vollzogen werden solle. Türpe wurde am 28.4.1882 zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt.
Dr. H. Schnurrbusch
[1] Der Mittelfrohnaer Ortsteil Kreuzeiche wurde 1931 nach Limbach eingemeindet.
[2] Das heutige Niederfrohna besteht aus den früher eigenständigen Orten Fichtigsthal, Mittelfrohna, Niederfrohna und Jahnshorn.
[3] Bekanntmachung der Staatsanwaltschaft Chemnitz im Augustusburger Anzeiger am 8.9.1881
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 20. August 2020 -
Der „Kreativ- und Verkehrsgarten“ in Oberfrohna
An der Stelle des heutigen Spielplatzes befand sich über mehrere Jahrhunderte die Oberfrohnaer Obermühle. Der Name kommt daher, dass der Ort noch eine Mittelmühle (Käferstein) und eine untere Mühle (Nickelmühle) besaß. Die Mühle bezog ihr Wasser aus dem Frohnbach über einen Mühlgraben entlang des Promenadenwegs für das Mühlrad und zum Füllen des „Schutzteiches“ als Reserve für Trockenzeiten. Die Mühle wurde schon 1584 als Schneide-, Mahl- und Ölmühle bezeichnet und war zumeist im Besitz der Familie von Schönberg auf dem Rittergut Limbach. Sie wurde von verschiedenen Pächtern betrieben, u.a. von Gräfe, Pester, Rätzer. 1875 brannte die Mühle ab.
Heinrich Rätzer gründete auf dem Gelände der Mühle eine Fabrik für Stoffhandschuhe ► Sein Grab ist auf dem Friedhof Hainstraße noch erhalten, seine Villa (im Hintergrund der Abbildung mit dem Türmchen) dient heute noch als Kindergarten, und die Heinrichstraße ist nach ihm benannt. Nach einer Blüte der Handschuhindustrie gelang es der Firma Rätzer nicht, sich auf die Produktion von Wirkwaren oder Unterwäsche umzustellen, sie ging in den 1920er Jahren in Konkurs. Die Gemeinde Oberfrohna erwarb das Gelände und die Gebäude.
Aus der Fabrik wurde ein Lager für den Arbeitsdienst, der in den Jahren 1935 bis 1938 mit 195 Männern u.a. den Sportplatz am Jahnhaus ausbaute. Nach dem Auszug des Arbeitsdienstes wurden die Unterkünfte weiter als „Volksdeutsche Lager“ genutzt für Umsiedler aus dem Baltikum, Wolhynien, Galizien, Bessarabien und für Kinder im Verlauf der „Kinderlandverschickung“.
Ab Juni 1945 kam wieder Vertriebene und Flüchtlinge ins „Lager“ z.B. aus dem Sudetenland, den deutschen Ostgebieten, jetzt polnischen Pommern, Schlesien, Ostpreußen. In Oberfrohna mussten etwa 2.000 „Neubürger“ untergebracht werden. Ab 1948 wurden die Fabrikräume zu 24 Wohnungen umgebaut. Im Oktober 1974 wurde im „Lager“ eine Konsum-Kaufhalle „Waren täglicher Bedarf“ eingerichtet, nachdem Dutzende privater Lebensmittelläden, Bäcker, Fleischer usw. dem Weg zum Sozialismus zum Opfer gefallen waren. Die Kaufhalle existierte bis 1994. Die leerstehenden Gebäude wurden zunehmend baufällig und 2002 abgerissen.
Die Brachfläche stellte 18 Jahre einen Schandfleck im Ortsbild dar, bis 2020 der erste und einzige Kinderspielplatz in Oberfrohna für mehr als eine halbe Million Euro entstand.
Der Spielplatz wurde am 17. Juli 2020 als Kreativ- und Verkehrsgarten eingeweiht.
© H. Schnurrbusch 2020
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 6. August 2020 -
Legendärer Baumriese in Pleißa
Nach der Ortsdurchfahrt Meinsdorf steigt die Straße an, wir sind auf dem Kapellenberg. Von hier aus kann man weithin ins Land schauen. Die Anhöhe ist immerhin 434 Meter hoch. In der Ferne sieht man bei klarer Sicht 50 km entfernt das Kraftwerk Lippendorf bei Leipzig. Einige Male konnte man von hier aus in etwa 70 km Entfernung sogar das Leipziger Völkerschlachtdenkmal erblicken. Dann kommt links die Einfahrt zu einem aufgeschotterten Feldweg, der ehemaligen Alten Meinsdorfer Straße in Richtung Pleißa. Der Feldweg führt auf dem Höhenrücken entlang und endet an der Pleißaer Kirche. Links das Rußdorfer Holz, ein sogenannter Bauernwald. Dort an der westlichen Ecke des Rußdorfer Holzes bzw. am Kapellenberg entspring auch der Folgenbach. Unmittelbar nach der Quelle am Waldzipfel hat man einen kleinen Teich angelegt, gesäumt von starken Bäumen: einer mächtigen Buche und einer Eiche. Früher stand dort in der Nähe, Errichtung ab 1720 und der Abriss 1877, eine Wassermühle, die Holzmühle. Nun konnten die Rußdorfer ihr Korn im Ort mahlen lassen und mussten nicht mehr „ins Ausland“ gehen. Das war der eigentliche Antrieb zum Bau dieser Wassermühle. Bekanntlich war Rußdorf früher eine Herzoglich Altenburgische Enklave mit hinderlichen Zollschranken und gehörte nicht zu Sachsen. Im Rußdorfer Holz sind aus damaliger Zeit noch Grenzsteine vorhanden, die das Altenburger Gebiet zu Sachsen markierten. Neben dem Mahlgang war vermutlich noch ein Sägegatter für die Holzbearbeitung vorhanden, deshalb der Name Holzmühle. Das angestaute Wasser der Mühlteiche ermöglichte den Gang des Wasserrades. Die Mühle entwickelte sich im Laufe der Zeit im Teichgebiet zum beliebten Ausflugsziel mit Ausschank für Spaziergänger am Wochenende. Wie üblich betrieb der Müller als Nebenerwerb eine Landwirtschaft mit Bäckerei. Die Gäste konnten auch das hölzerne Wasserrad bewundern, welches den Mahlgang antrieb. Der Chronist Paul Fritsching hat sich dies 1938 von noch lebenden Zeitzeugen berichten lassen. Die Holzmühle gab man aber wegen des zu geringen Wasseraufkommens bald auf. Weitere Gründe waren das Fortschreiten der Technik und das Zurückdrängen feudaler Gepflogenheiten. Jetzt konnte über die Eisenbahn viel billigeres Mehl angeliefert werden. Einige der Mühlteiche sind heute noch vorhanden. Nun kommen wir wieder zur westlichsten Ecke des Rußdorfer Holzes. An der Grenze zur Flur Pleißa kann man Waldrand die schon erwähnte majestätische Buche bewundern. Das Alter wird auf mindestens 200 Jahre geschätzt. Das ist der stärkste Baum im Limbacher Land, viel stärker wie die Hanneloreneiche – Umfang 5,62 m. Der Stammumfang der Buche beträgt - 1 m über Gelände gemessen - 7,05 Meter. In der Rinde des Stammes hatten sich früher zahlreiche Schulbuben mit Initialen verewigt, in der Zeit in der jeder Junge in der Hosentasche noch ein Taschenmesser hatte. Im anschließenden Rußdorfer Holz gibt es von Naturschützern (NABU) vielfältige beispielgebende Aktionen zur Renaturierung. So pflanzte man an Feldwegen Gehölze an und rodete eine Monokultur, ein Stück Fichtenwald, setzte dafür Laubbäume. Besonders zu erwähnen sind die Bemühungen von Ornithologen, die sich um den Erhalt seltener Vogelarten kümmern. Im Teichgebiet der Mühlteiche ist der Fischotter seit kurzem wieder heimisch, das Grünfüßge Teichhuhn und das seltene Blaukehlchen wurden festgestellt. Große Ärgernisse für Naturschützer sind die Auswirkungen der modernen Landwirtschaft mit ihren Monokulturen und besonders der Anwendung des Giftes Glyphosat. Eine weitere starke Buche der Region befindet sich in Bretschneiders Wäldchen, nach dem Ortseingang von Bräunsdorf mit ebenfalls über 5 Meter Stammumfang.
Friedemann Maisch
Quellen: Heimatgeschichte, Heft 47 – Mühlen, Mitarbeiter NABU; Fotos F. Maisch
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 9. Juli 2020 -
70 Jahre Vereinigung von Limbach und Oberfrohna 85 Jahre Stadtrechtsverleihung an Oberfrohna
Erwachsend aus einer gleichzeitigen Besiedlung im 12. Jahrhundert entwickelten sich die Ortschaften Limbach und Oberfrohna in ähnlichen Bahnen. Nachdem Anfang des 18. Jahrhunderts durch Johann Esche und die Familie von Schönberg in Limbach die Strumpfwirkerei etabliert wurde, begann der Aufstieg unserer Region zum Zentrum der mittelsächsischen Wirkindustrie. Die umliegenden Ortschaften wurden in diesen Entwicklungsprozeß mit eingebunden; so ließ sich schon 1729 Johann David, ein Sohn des Johann Esche, in Rußdorf nieder. Der neue Industriezweig führte zu einem raschen Bevölkerungsanstieg, was man an dem Zuwachs der Bevölkerung Limbachs von 300 um das Jahr 1750 auf 1.200 Einwohner 1794 ersehen kann. Dieser Zuwachs kam aber auch durch die Förderung der Rittergutsbesitzerin Helena Dorothea von Schönberg zustande, welche zwischen 1750 und 1785 die ersten planmäßigen Wirkersiedlungen Deutschlands anlegen ließ. Im Zuge der Verbreitung des Wirkwesens wurden die Produktionszweige immer mehr differenziert und dabei zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch mit der Produktion verschiedener Handschuhe begonnen. Der damit verbundene Bedeutungsanstieg der Region ließ sich auch an der Verleihung des Marktrechts für die Gemeinde Limbach im Jahre 1795 erkennen. Aber gerade der wirtschaftliche Aufstieg der Gemeinden führte im 19. Jahrhundert zu einem größeren Eigenständigkeitswunsch, welcher sich u.a. darin zeigte das Oberfrohna 1827 und Kändler 1837 eigene Schulen einrichteten und sich damit aus der gewissen Abhängigkeit von Limbach lösen konnten. Auch in den folgenden Jahren entwickelte sich die Region gerade während der Industriellen Revolution weiter, was sich v.a. im Bau großer Fabriken ab 1850 zeigte. Die wachsende Bedeutung und Größe der Gemeinde Limbach konnte dann auch von der Regierung des Königreichs Sachsen nicht weiter ignoriert werden und so kam es am 1. Januar 1883 nach 53 Gesuchen zur Verleihung des Stadtrechts. Ende des 19. Jahrhunderts erlebten die beiden Ortschaften Limbach und Oberfrohna einen bedeutenden Ausbau des sozialen und gesellschaftlichen Lebens. So bekam Limbach u.a. eine Gasanstalt, Straßenbeleuchtungen, Bürgerschulen, eine Wirkschule und eine Stadtbibliothek. Oberfrohna wurde gleichzeitig durch die Einrichtung eines Postamts, einer Apotheke und einer eigenen Kirche in seiner Selbständigkeit gefestigt. Aufgrund der weiteren Bevölkerungs- und Bedeutungszunahme kam es dazu, daß der Reichsstatthalter in einem Erlass des Sächsischen Ministers des Innern vom 29. Mai 1935 der Gemeinde Oberfrohna die Bezeichnung „Stadt“ verlieh, nachdem bereits wenige Wochen zuvor Rußdorf nach Oberfrohna eingemeindet worden war. Kurz vor Kriegsende am 14. April 1945 wurden die Städte von den Amerikanern besetzt, jedoch am 8. Juni an die Sowjets übergeben. In den nächsten Jahren strebte Limbach mehrfach die Eingemeindung Oberfrohnas an, scheiterte aber immer an der Zustimmung des Kreistages. Erst das durch den Landtag am 27. April 1950 verabschiedete „Gesetz über die Änderung der Kreis- und Gemeindegrenzen“ gab die Voraussetzung zur Vereinigung, welche durch ein Gesetz vom 27. Juni zum 1. Juli durchgeführt werden sollte. Nachdem die Stadtverordnetenkollegien der beiden Städte mit gewissen Bedenken dem Zusammenschluss zugestimmt hatten, trafen sich am 30. Juni beide Stadträte zu einer abschließenden Beratung, in welcher der Vereinigung „einmütig zugestimmt“ wurde. In den letzten 70 Jahren hat sich das Gesicht der vereinigten Stadt, insbesondere nach der friedlichen Revolution 1989, an vielen Stellen gewandelt. So ist die jahrhundertealte und stark ausgeprägt gewesene Textilindustrie fast völlig aus dem Stadtbild verschwunden, wofür sich neue Industriezweige angesiedelt haben. Limbach-Oberfrohna bietet heute mehr denn je einen gesellschaftlichen, landschaftlichen und touristischen Reiz, welcher besonders durch die zahlreichen städtischen Einrichtung und die verschiedenen Ortsteile unterstützt wird.
Christian Kirchner, Stadtarchivar
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 25. Juni 2020 -
Die erste Wirkersiedlung Deutschlands
Durch die Wirkerei wuchs die Bevölkerungszahl Limbachs in wenigen Jahren fast auf das Doppelte. Im Tal des Dorfbaches drängten sich die Häuschen. In ihnen wimmelten Junge und Alte, Kranke und Gesunde, Männlein und Weiblein neben dem großen und kleinen Handwerksgerät. Es schien aussichtslos, neues Bauland zu erwerben, denn um die Häuschen im Tal erstreckten sich die Fluren der Bauern auf der einen und die der Herrschaft oder der Kirche auf der anderen Seite.
Doch dann verbreitete sich die gute Nachricht, die Herrschaft wolle Land zum Bauen freigeben und habe am Knauholz schon den Bau einer Ziegelei und einer Lehmgrube[1] geplant. Und tatsächlich gab Georg Anton von Schönberg auf besonderes Drängen seiner Ehefrau Helena Dorothea das gesamte Rittergutsgebiet, das früher zu den Bauergütern Anke und Baldauf gehört hatte, als Siedlungsland frei. Die Herrschaft teilte den Untertanen das Bauland großzügig zu. Dort wo der Boden bereits urbar und bewirtschaftet war, war ein Bauplatz einen halben Scheffel Land groß. (1 Scheffel Landes = 2.767 m²) groß. Von der Anhöhe des Dorotheenbergs bis zur Vorwerksbrücke über den Frohnbach am tiefsten Punkt der heutigen Dorotheenstraße war „wüstes“ Weide- und Buschland. Dort gab es einen ganzen Scheffel Land.
Mit einem Male wurden 71 Bauplätze zu einem halben und 22 Grundstücke zu einem ganzen Scheffel geschaffen, die aus feudalem Besitz „ohne Entgeld“, d.h. ohne Kaufpreis an die Bauwilligen übergingen. Die mussten dafür aber Zins, Steuer und andere Lasten übernehmen. Der neue Besitzer bezahlte einen jährlichen Erbzins in Höhe von 3 Talern. Das hatte für beide Seiten Vorteile: Der Käufer hätte die Kaufsumme nicht mit einem Male aufbringen können, der Verkäufer hatte eine Dauereinnahme. Zum Erbzins kam eine Art Einkommenssteuer[2] und die Grundsteuer an den Staat. Der Käufer übernahm aber auch die örtlich üblichen Dienste für die Herrschaft: drei Frontage im Jahr, das Spinnen einer langen Weife[3] Flachsgarn, der Beitrag zu etwaigen Gerichtskosten bei Verhandlungen gegen hiesige Untertanen und die Ableistung der Arrestantenwache, die notwendig wurde, wenn ein Untertan arretiert (eingesperrt) wurde und bewacht werden musste. So entstand die erste, planmäßig angelegte Wirkersiedlung Deutschlands als anfangs selbständige Niederlassung.
Im Herbst des Jahres 1750 stand auf dem Helensberg das erste Haus der Neusiedlung, erbaut vom Musikanten und Zwillichweber Heinrich Lasch. Andere Häuser folgten Jahr für Jahr, bis der erste Teil die Höhe hinauf rechts und links des Weges (daher auch der Name „Doppelgasse“) bebaut war. Der zweite Teil von der Höhe zur Vorwerksbrücke hinab hatte nur einseitig eine Reihe Häuser. Nach wenigen Jahrzehnten hatte Limbach die zwei von aller Welt bestaunten und dichtbesiedelten neuen Ortsteile Helensberg und Dorotheenberg. Das winzige Bauerndörfchen entwickelte sich sichtlich zum Industriedorf. Es hatte 1793 etwa 1.200 Einwohner, 1745 waren es noch ungefähr 300 gewesen.
Dr. Hermann Schnurrbusch
[1] Heute etwa die Gegend um die Straße am Försterhäuschen.
[2] Die sogenannte Quatembersteuer viermal im Jahr nach lat. quatuor tempora: vier Fastenzeiten im Kirchenjahr.
[3] Garnmaß, 1 sächsische Weife = 1 Stückgarn = 4 Strähn = 12 Zaspel = 240 Gebinde = 480 Fäden = 10.970 Meter
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 28. Mai 2020 -
Erinnerungen des Pfarrers Bitterlich vom 14.April 1945
(Pfarrer in Rußdorf seit 1911)
Schweres Ahnen ließ uns in den Tagen vor dem 14. April 1945 in Rußdorf nicht zur Ruhe kommen. Und wir blickten Bange der Zukunft entgegen. Radio und Zeitungen brachten zwar beruhigende Meldungen. Der Amerikaner wäre in der Eifel festgesetzt. Aber das immer mehr vernehmbare Grollen der Geschütze ließ uns richtig vermuten, dass der Amerikaner bereits bis Thüringen vorgedrungen und damit nicht mehr weit entfernt sein könnte. Am Donnerstag den 12. April hieß es gerüchteweise auf einmal, dass er schon vor Altenburg stände. Allein kurz darauf im Radio die Meldung, die gerade das Gegenteil besagte. Am Freitag den 13. April hatte ich in meiner Eigenschaft als Lazarettpfarrer im benachbarten Oberfrohna zwei Beerdigungen. Die eine war eine Lazarett-Beerdigung. Es galt einen toten Kameraden der Erde zu übergeben. Bei dieser Beerdigung kreisten bereits die Feindflugzeuge über Oberfrohna und Rußdorf und zwar im Tiefflug. Wir befanden uns in Lebensgefahr. Als die zweite Beerdigung beginnen sollte, heulten die Sirenen unheimlich lange. Das bedeutete, dass wir uns bereits in Feindberührung befanden. In höchster Eile und wieder in ständiger Tieffliegergefahr mussten beide Beerdigungen erfolgen und dann ging es in jagender Hast nach Hause. Unterwegs musste ich mehrere Male in Deckung gehen. Zuletzt im Haus Querstraße 8, da Geschosse aus Bordwaffen um uns herum pfiffen.
Zu Hause angelangt fand ich meine Frau in fieberhafter Eile vor, Sachen einzupacken. Ein Fernruf von befreundeter amtlicher Stelle, informierte, dass Panzerspitzen bereits bis Borna bei Leipzig vorgestoßen waren. Alles was nötig erschien, wurde verpackt und im Heizkeller der Kirche, im Luftschutzkeller der alten Schule (unsere Pfarre besitzt keinen Keller) verstaut. Bis in die sinkende Nacht wurde gepackt und verstaut. Nur sehr unruhig verstrich die Nacht. Gerüchte besagten, dass der Feind immer näher heranrückte und bereits das nahe Falken erreicht haben sollte. Am westlichen Ende des Dorfes wurde vom Volkssturm Panzersperren errichtet, das Dümmste was man in dieser Lage tun konnte. Die am Gemeindewald und in Rußdorf befindliche Artillerieabteilung der Wehrmacht zeigte sich auch schon ziemlich kopflos. Niemand wusste recht, was zu tun sei und wie sich alles gestalten würde. Der die Abteilung führende Hauptmann Fleck hatte gemäß des Befehls des in Limbach kommandierenden Offiziers geäußert: „Limbach und Rußdorf werden bis zum letzten Mann verteidigt“ (Anm. allgem. Befehl des Führers, ansonsten standrechtliche Hinrichtung). Der fanatische Limbacher Bürgermeister Dr. Jokesch erklärte nun die Stadt zur Hauptkampflinie. Der NSDAP-Ortsgruppenleiter Otto Prater war angeblich bereit, Rußdorf kampflos zu übergeben (Anm., so behauptete er später). Was wohl auch das Richtigerer gewesen wäre. Viel Not und Elend wäre uns erspart geblieben.
So brach der 14. April an, ein trüber Frühlingstag. Schon frühzeitig ertönten die Sirenen – Fliegeralarm. Sie hörten gar nicht mehr auf zu heulen. In allernächster Nähe grollte Geschützdonner und es peitschten Schüsse. Da - klatsch am Götzehaus, Kirchweg 31, schlug eine Maschinengewehrkugel Putz ab. Und nun setzte ein Pfeifen und Krachen ein, das nicht mehr aufhörte. Alle Leute und auch wir bezogen fluchtartig die Keller. Wir eilten in den Luftschutzkeller der benachbarten alten Schule und harrten der Dinge die da kommen sollte. Stunden furchtbarster Angst und Spannung folgte. Es folgte ein Schießen ohne Ende, ein Krachen als ob die Höllentüren geöffnet seien. Der Luftschutzkeller war voller Menschen, niemand wagte sich ins Freie. Schüchtern wagten wir den Kopf zur Tür hinauszustecken. Gegen 11 Uhr sahen wir die ersten Häuser brennen. Jemand sagte, das ist bei Wirts, und das war das alte Erbgericht, jetzt im Besitz der Sebastians. Es brannte der Stall und die Scheune. Entlang dem Kirchweg brannten einige Häuser. Und bei Paul Welker (Anm. heute Bauer Gotthard Fichtner) an der Waldenburger Straße brannte das Wohnhaus mit Stall und Scheune lichterloh. Bei Artur Welker an der Feldstraße brannten die Scheune und viele andere Anwesen im unteren Dorf. Rußdorf brannte an insgesamt elf Stellen. Dazu flogen uns Splitter vom Kirchturm um die Ohren. Dieser wurde durch Beschuss erheblich beschädigt. Wir befürchten nun, dass die Kirchturmspitze herunterfallen würde, sollte der Beschuss noch andauern. Zum Glück geschah das aber Gott sei Dank nicht. Der alte Turm bestand seinen Kriegs-und Feuerprobe.
Auf der Dorfstraße kamen die ersten Amerikaner, wir waren noch im Keller. Sie gingen in die Häuser und auch in unsere Pfarre. Am Haus Nr. 31 wehte bereits die weiße Fahne (Anm. auf das Hissen der weißen Fahne stand lt. Führerbefehl ab 1944 die Todesstrafe). Minuten höchster Spannung folgten. Würden wir unsere Pfarre jemals wieder betreten können? Und wenn ja, wie würden wir sie wiederfinden? Wir hörten, dass in der alten Schule die Tritte auf der Treppe auf und abgingen. Zwei weiter Amerikaner kamen die Dorfstraße entlang. Sie vermuteten in der Pfarre deutsche Soldaten, es waren aber ihre eigenen Leute darin. Da ergriff einer der Soldaten ein etwas an der Seite hängendes Etwas und wirft es durch das bereits zertrümmerte Fenster im Erdgeschoss in das Amtszimmer. Ein Krachen, ein Phosphorgranate war hineingeworfen worden. Im gleichen Augenblick erscheinen in der Haustür die im Haus befindlichen Amerikaner. Sie überschütten die anderen Soldaten mit heftigen Vorwürfen und gingen dann zusammen weiter. Aus dem Fenster scheint grünliches Phosphorfeuer, die Pfarre brennt. Im Nu stürze ich in die Pfarre, reiße dort Fenster und Türen auf und suche sofort wieder den Hausflur zu erreichen. Dann zog ich mit einer Gartenharke das brennende Sofa in den Hausflur holte einen Eimer Wasser und versuchte den Brand zu löschen. Überall ätzender Qualm. Meine Frau und der Sohn des Kantors halfen mir bei der Brandbekämpfung. Dann war die Feuergefahr endlich beseitigt.
Der Hausflur glich einem See, das Amtszimmer sah fürchterlich aus, überall noch glimmende Phosphorspritzer, Brandflecke an den Vorhängen und den Möbeln Ein Bild des Jammers. Nicht beschädigt waren die beiden eisernen, innen mit Asbestplatten versehen, Archivschränke, in denen die alten Kirchenbücher und die Gemeindekartei aufbewahrt waren. Der Anblick der anderen Räume war ebenfalls furchtbar. Im Konfirmandenzimmer, in dem sich die Koffer meiner beiden gefallenen Söhne befanden, gleichfalls ein Bild wüsten Durcheinanders. Die Koffer aufgebrochen, die Sachen wahllos verstreut. Dasselbe Bild in meiner Wohnung in der oberen Etage. Kein Kasten und Schrank unversehrt, die Inhalte geplündert, verstreut oder zerstört. Der Radioapparat zertrümmert, allen Schmuck darunter zwei Armbanduhren gestohlen. Der Fernsprechapparat und der Abendmahlwein wurden ebenfalls gestohlen. Diese Verwüstungen waren innerhalb weniger Minuten geschehen. Alles im allen – ein Anblick zum Weinen. Und trotz allen hatten wir noch Grund zum Danken. Unser Haus war nicht abgebrannt und stand noch. Obwohl der Kirchturm und das Kirchendach einige Treffer erhalten hatte, war die Kirche selbst unversehrt. Vor allem der neue Orgelspieltisch war unbeschädigt geblieben.
Umso trostloser sah es im Niederdorf aus. Bei Paul Welker und Max Rödel war das Wohnhaus, Scheune und Stall völlig niedergebrannt. Ebenso waren die Güter von Paul Richter und Walter Rothe völlig eingeäschert. Bei Heinzigs, Artur Welker, Goldhahns und bei Martha Esche blieb es bei niedergebrannten Scheunen. Die Häuser auf der Hohensteiner Straße (Anm. heute Langenberger Straße) hatten alle unter Feindbeschuss von der Falkener Höhe gelitten. Vom Dach der Schule, die als Lazarett diente und voller Verwundeter lag, wehte eine Rot-Kreuz-Fahne. Die Schule blieb deshalb verschont. So zeigte sich Rußdorf um die Mittagszeit des 14. April 1945 in einem trostlosen Bild und in einer wüsten Zerstörung. Und das alles, weil Rußdorf als Kampfgebiet erklärt wurde und die Wehrmacht die heranrückenden Amerikaner mit Geschützen (Anm. von Grimms Steinbruch aus) und Infanteriewaffen im Häuserkampf beschoss. Wäre das nicht geschehen und der Ort kampflos übergeben worden, wäre nicht solches unfassbare Elend uns erspart geblieben. Unbeschreibliche Bilder. Übrigens jener Hauptmann Fleck, der den Befehl „kämpfen bis zum letzten Mann“ ausführen musste, versuchte beim Heranrücken des Feindes zu flüchten. Er hatte sich das Auto des Ortsarztes Dr. Brummer widerrechtlich angeeignet. Fleck wurde bei der Flucht an der Fabrik Hermann Dittrich (Anm. heute Waldenburger, Ecke Frohnbachstraße) am Kopf verwundet. Das Auto wurde dann von den Amerikanern beschlagnahmt. Der 13. April 1945 dürfte wohl in der Geschichte Rußdorf der schwärzeste Tag gewesen sein. Überall unbeschreibliches Elend und Not.
Rußdorf lag an diesem Tag in der Hauptkampflinie. Die Amerikaner brachten auf dem Kuber (Anm. Meinsdorfer Straße, Ecke Hohe Straße) und in der Wiesenstraße schwere Geschütze in Stellung um den Beschuss von Chemnitz vorzubereiten. Es wurde dort ein wahres Heerlager errichtet. Viele Rußdorfer Bewohner mussten die eigenen Wohnungen verlassen um den amerikanischen Soldaten Unterkunft zu gewähren. Auch im unteren Dorf versuchten die aus den Häusern Vertriebenen eine Unterkunft zu erhalten. Das Pfarrhaus blieb von der Einquartierung der Amerikaner verschont. Diese respektierten nun kirchliches Eigentum.
Die Kämpfe in Rußdorf forderten fünf Todesopfer unter deutschen Soldaten (Anm. und drei bei den Amerikanern). Die fünf Wehrmachtssoldaten wurden am 16. April um 3 Uhr auf der Ehrenabteilung unseres Gottesackers, und unter Beteiligung von Kameraden des hiesigen Lazarettes zur letzten Ruhe gebettet. Ein echtes Feldbegräbnis, sehr einfach und sehr würdig. Außer diesen Soldaten waren noch fünf weitere Einwohner ums Leben gekommen (Anm. und zwei Zivilisten in Oberfrohna). Unsere Leichenhalle hat noch nie so viele Tote beherbergen müssen, wie in diesen mittleren Apriltagen 1945. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass sich die Amerikaner dann recht zivilisiert benommen haben. Als wir bei der Beerdigung am 16.4.45 mit den Särgen an ihnen vorbeizogen, sie waren zufällig an der Feldstraße, nahmen sie ihre Stahlhelme vom Kopf und verharrten still. Am 3. Mai erschien bei mir im Amtszimmer der Pfarre Capitain David Green, ein Bevollmächtigter des Ortskommandanten und erkundigte sich nach meinen Wünschen bezüglich der Fortführung des kirchlichen Lebens.
In den Wochen nach dem 14. April war Rußdorf ein amerikanisches Heerlager, mit großer Anziehungskraft für die Schuljugend. Ich führte nun meine Tätigkeit als Lazarettpfarrer weiter, betreute die vollbelegten Lazarette in der Rußdorfer und Oberfrohnaer Schule sowie im Jahnhaus.
Wie Blei liegt es aber auf den Gemütern, dass wir zwölf Jahre lang auf das schändlichste betrogen worden sind. Alle Opfer, die gebracht worden sind, waren vergeblich. Das ist für einen Vater sehr schwer, der zwei Söhne in diesem Krieg verloren hat und dessen dritter Sohn als vermisst gilt (Anm. auch dieser war gefallen)
Friedemann Maisch
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 30. April 2020 -
Die legendäre Heiniglinde in Rußdorf
Die mächtige und uralte Linde befand sich auf einer Böschung mitten in einer Feldflur westlich der Langenberger Straße in Rußdorf. Allerdings war das schon die Flur Falken und hart an der ehemaligen Grenze vom Herzogtum Altenburg zum Kurfürstentum Sachsen. Einige Grenzsteine der Enklave Rußdorf (1457-1928) wurden von Bürgern gesichert, sie findet man noch in manchen Grundstücken der anliegenden Langenberger Straße. Der Besitzer des Grundstücks mit der alten Linde war der Landwirt Heinig aus Falken. In den 1920er Jahren war die Linde ein wahrerer Bilderbuchbaum, so zeigt es ein Dia aus dem Esche-Museumsfundus (Foto oben). 1930 wurde ein Stammumfang von sechs Meter ermittelt. Damit konnte ein Alter von ca. 300 Jahre geschätzt werden. Wie der Chronist Paul Fritsching berichtete, war die Rußdorfer Linde in den 1930er Jahren der stärkste Baum weit und breit, mächtiger als die legendäre Hanneloreneiche. Auf dem Foto (unten) mit dem Schulmädchen, welches 1957 entstand, sieht man, dass es tatsächlich ein stattlicher Baum war. Der Stamm war recht kurz und schon damals innen hohl. Bei alten Linden ist das nichts Ungewöhnliches und sie sind trotzdem standfest und trotzen so auch Stürmen. Der Baum war zweimal Opfer von Brandstiftungen durch „böse Buben“ in den 1920er und in den 1960er Jahren. Die hohle Linde war ein beliebter Abenteuerspielplatz der Rußdorfer Kinder. Ich kenne Leute, jetzt allerdings im Greisenalter, die sich im Kindesalter durch einen Spalt in das Innerer des Baumes gezwängt und dort mit Streichhölzern gekokelt hatten. Den Gnadenstoß bekam die Linde beim letzten Brand am 9. September 1963. Die herbeigerufene Rußdorfer Freiwillige Feuerwehr riss den Baum mit Haken zwecks Brandbekämpfung auseinander (Quelle: Feuerwehrmann und Gastwirt Manfred Sittner, 1936-2014). Ringsherum waren aber grüne Wiesen, es konnte nichts weiter anbrennen. Man wollte nicht die schwere Motorpumpe mit den wenigen Männern über die unwegsame und sumpfige Wiese zum nahen Teich schleppen, um Löschwasser zu bekommen. Das nachfolgende Zerstörungswerk am Baumriesen war nicht notwendig, aber die Feuerwehr wollte ihr Werk mit einem Finale beenden und den Brand löschen. Bis in die 1970er Jahre lagen noch Reste der Linde auf der Böschung, daran kann ich mich erinnern. Dort an der Flurgrenze zu Falken am ehemaligen Standort der Heinig-Linde sind inzwischen durch Neupflanzung von Rußdorfer Heimatfreunden zu Beginn der 90er Jahre durch wieder zwei junge Linden gewachsen, die auf der Böschung hoffentlich niemandem im Wege sind. Sie sollen als Erinnerung an die legendäre Heiniglinde anknüpfen. So bleibt uns heute nur noch der Anblick der stattlichen Linde mit 5,47 Meter Stammumfang beim Landwirt Wilfried Vogel in Bräunsdorf, der mächtigsten Linde im Limbacher Land oder die in Falken unweit des Gasthofes, mit einem Stammumfang von 5,24 Meter. Wem das nicht ausreicht, der besucht die ebenfalls hohle 9 Meter Linde in Dorf Sorgau bei Pockau/Erzg. oder die mächtigsten und ältesten Linden Sachsens in Collm bei Oschatz oder die an der Kirche in Dresden-Kaditz.
Friedemann Maisch
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 5. März 2020 -
Anna Esche 100. Todestag
Anna Esche 100. Todestag
Förderverein Esche-Museum e. V.
Am 16. Februar jährt sich der Todestag von Anna Esche zum 100. Mal. Das ist Anlass, sich wieder einmal in Erinnerung zu rufen, wer diese Frau war, nach der in Limbach-Oberfrohna sogar zwei Straßen benannt sind: das Anna-Esche-Gässchen und die Anna-Esche-Straße.
Anna Clara Esche wurde 1824 in Chemnitz geboren als Tochter von Henriette Sophie, geb. Rahlenbeck, und dem Gründer der Spinnerei in Flöha Peter Otto Clauß.
Am 18. 10.1844 heiratete sie den Limbacher Arzt Dr. Carl Julius Esche, der in vierter Generation von Johann Esche abstammt und ab 1847 als Teilhaber in die Firma Moritz Samuel Esche eintrat, die er mit seinem Bruder Theodor gemeinsam führte. Das Ehepaar wohnte in der Villa am heutigen Anna-Esche-Gässchen. Anna und Julius bekamen drei Kinder.
Nach dem Tod ihres Mannes kümmerte sich Anna Esche bis ins hohe Alter um soziale Belange in Limbach. Ihr erstes Projekt war 1882 die Gründung einer „Kinderbewahranstalt“, in der noch nicht schulpflichtige Kinder berufstätiger Frauen gegen ein geringes Entgelt ganztägig betreut wurden. Frau Esche gehörte von Anfang an dem Vorstand dieser Einrichtung an und zählte zu den tatkräftigsten Förderern. Hatte sie bisher schon jährlich 600 Mark gespendet, stiftete sie im Jahre 1890 15.000 Mark von gesamt 18.000 für einen Neubau, der 1890 eingeweiht wurde. Das war die erste Kindertagesstätte unserer Stadt und war mit großen Aufenthaltsräumen und Garten erstaunlich modern. Sie bot 40 bis 60 Kindern Aufenthalt und Betreuung.
In der Inflation 1923 geriet die Einrichtung in wirtschaftliche Schwierigkeiten, und die Firma Johannes Richter erwarb das Gebäude.
1887 wurde Anna Esche Mitbegründerin und Vorsitzende des Albert-Zweigvereins Limbach. Dieser im Jahre 1867 in Dresden gegründete Frauenverein des Roten Kreuzes war nach König Albert von Sachsen benannt und widmete sich in Friedenszeiten karitativ der Armenpflege. Hauptaufgabe war die Betreuung sozial Benachteiligter und Kranker, die Verteilung kostenloser Lebensmittel und die Unterstützung von Familien, die fremde, oft uneheliche Kinder aufzogen.
Für ihr soziales Engagement wurde Anna Esche 1896 zur ersten Ehrenbürgerin der Stadt Limbach ernannt. Auch das Königreich Sachsen verlieh Anna Esche hohe Auszeichnungen, so 1894 die silberne Carola-Medaille für ihre Verdienste auf dem Gebiet hilfreicher Nächstenliebe und 1896 mit derselben Begründung die Carola-Medaille in Gold. Anna Esche starb 96-jährig, bis zuletzt geistig rege und hoch geehrt.
Von ihr und ihren Kindern stammten verschiedene Schenkungen und Stiftungen für soziale Zwecke, so z.B. die „Geschwister-Esche-Stiftung“, deren jährliche Zinserträge bedürftigen Männern und Frauen über 60 Jahre „zur Bezahlung von Wohnung und Feuerung“ zugutekamen.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 6. Februar 2020 -
Als die Oma einkaufen ging …
Als die Oma einkaufen ging …
Dr. Hermann Schnurrbusch
… gab es noch keine Kaufhalle, weder Diskounter noch Einkaufs-Center oder die Möglichkeit, etwas online zu bestellen. Dafür gab es eine Vielzahl winziger „Tante-Emma-Läden“ mit kleinem Sortiment, aber an jeder Ecke bequem zu erreichen. Wer dort Zucker oder Mehl kaufte, bekam die entsprechende Menge in eine Papiertüte abgefüllt. Salzheringe befanden sich in einem Fass und wurden in Zeitungspapier eingewickelt – Kunststoff-Verpackungen gab es noch nicht.
In Oberfrohna gab es Mitte der 1930er Jahre zehn Bäckereien, Käferstein, Kraus, Landgraf, Lunkwitz, Mann, Sachse, Schettler, Sonne, Uhlmann, Werner. Neun Fleischereien: Ahnert, Georgi, Hainich, Jost, Knöbel, Landgraf, Mäder, Schramm, Wolf; 26 Lebensmittel-Läden, früher auch Kolonial- oder Materialwarenhandlungen genannt. Als Kolonialwaren wurden überseeische Lebens- und Genussmittel bezeichnet, wie z. B. Zucker, Kaffee, Tabak, Reis, Kakao, Gewürze und Tee, dazu fünf Tabakwarenhandlungen. Es gab neun Friseure: Bula, Hengst, Janich, Kluge, Nitzschke, Schulz, Stibinger, Voigt, Wichmann, neun Gastwirtschaften: „Heiterer Blick“, Harzendorf, „Zur Post“, „Zur Krone“, „Rautenkranz“, „Germania“, „Jahnhaus“, dazu zwei Kaffees: Brumm und Falke (Richter), 13 Schuhmacher und vier Schuhwarenhandlungen und noch vieles andere.
Einige dieser Läden existierten bis in die 1950er Jahre, danach waren sie der Konkurrenz der staatlichen Handelsorganisation HO (ohne Lebensmittelmarken!) und der genossenschaftlichen Konsum-Läden nicht mehr gewachsen und starben aus. Der Staat steuerte über die Belieferung und Besteuerung das Absterben der unerwünschten privaten, selbständigen, kapitalistischen Unternehmen zugunsten der „volkseigenen“. Bis auf Ausnahmen verschwanden sie bis etwa 1970. Lange hielt sich zum Beispiel „Korbs Hannel“ gegenüber von Hermann Grobe. Heute gibt es noch den Bäcker Käferstein, den Fleischer Knöbel, den Friseur Bula, das Gasthaus Harzendorf (Vogels).
Nach der Weltwirtschaftskrise erreichte Deutschland 1936 wieder Vollbeschäftigung bei niedrigen, auf das Niveau von 1932 eingefrorenen Löhnen. Die Oberfrohnaer hatten ein bescheidenes, aber relativ sicheres Einkommen. Die Entwicklung der Wirtschaft war nicht nur abhängig von Krise und Konjunktur, von Rohstofflage und Absatzmöglichkeiten, Handelssperren oder Anbindung an Schiene und Straße oder anderen äußeren Bedingungen. Wesentlich beeinflusst war die Prosperität vom Fleiß, der Qualifikation sowie dem Engagement tausender Arbeiter und Angestellter. Das alles hätte aber keinen Erfolg gehabt ohne den Einsatz, das Kapital, die Risikobereitschaft, das Innovationsstreben sachkundiger Unternehmer, damals Fabrikanten genannt. In den Firmen der Textilindustrie in Oberfrohna (1939 ca. 10.000 Einwohner) hatten elf Firmen 1939 mehr als 100 Beschäftigte:
Herrmann Dittrich 602 Beschäftigte (Arbeiter, Angestellte, Heimarbeiter), Carl Fritzsche Sohn 264, A. Engelmann 150, Georgi & Weißbach 213, Carl Götze 309, Hermann Grobe 504, Arthur Haustein 204, Erhard Kunze 218, Kühnert & Sohn 128, Emil Mahn 112, Hermann Schaarschmidt jr. 123, Hermann Tuchelt 136, Welker & Söhne 306. Zusammen etwa 6.000 Beschäftigte.
Dazu kamen etwa 75 kleinere Firmen, zusammen auch mit rund 1.000 Mitarbeitern: zum Beispiel O. Aurich, C. Bauer, J. Bauer, W. Baumann, R. Drescher, W. Döring, E. Eidner, E. Enge, H.E. Ernst, C.R. Fischer, F.G. Franke, A. Frischmann, C. Fritzsche Sohn, E. Geißler, C. Hähle, L. Hemman, O. Herold, G. Hummitzsch, K. Hendel, A. Irmscher, G. Kadelbach, G. Kempter, E. Kühn, E.A. Kühn jr., M. Landgraf, M. Lesch, A.C. Müller, J.W. Nitzsche, E. Peters, P. Petzold, J. Püschmann, R. Quellmalz, N. Reich, E. Richter, M. Roscher, E. Sonntag, A. Sahr, H. Schnurrbusch, Schulze & Grobe, P. Schüßler, F.E. Steinert, A. Vogel und andere.
Zu den Firmen kamen noch die Zulieferer der Textilindustrie: Trikotstoffhersteller, Färbereien, Nähmaschinen- und Wirkmaschinen-Fabriken, Betriebe für Kartonnagen oder der Metallwarenherstellung. Alle diese Firmen gibt es heute nicht mehr.
Obendrein gaben zahlreiche Handels- und Gewerbeunternehmen vielen Beschäftigten Lohn und Brot: Bauunternehmer, Buchbinder, Dachdecker, Druckereien, Elektroinstallateure, Gärtner, Klempner, Landwirte, Maler, Ofensetzer, Schlosser, Schmiede, Schneider, Spediteure, Stellmacher, Tischler und Glaser und andere. Zeitweise hatte die Stadt mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Oberfrohna war vor dem Krieg eine lebendige, fleißige, auch wohlhabende und erfolgreiche Stadt.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 30. Januar 2020 -
Vergessene Burgen und Rittersitze (1) Wolkenburg und Drachenfels
Vergessene Burgen und Rittersitze (1)
Wolkenburg und Drachenfels
Rolf Kirchner
Wohl kaum eine Burg hat in der Vergangenheit die Fantasie so angeregt, wie die wüste Burgstätte Drachenfels an der Zwickauer Mulde unterhalb von Penig gelegen. Neben historisch belegbaren Fakten existieren eine Vielzahl von Theorien, Ansichten, Meinungen und Vermutungen über die Gründung und die Geschichte dieser Burg. Oftmals wird sie losgelöst als „Einzelburg“ betrachtet. Man sollte diese Burganlage aber besser im gesamtdeutschen Zusammenhang betrachten. Am Wahrscheinlichsten ist, dass die Drachenfelser und die mit ihnen verwandten Wokenburger (ursprünglich von Wolkenburg) aus dem Rheinischen Siebengebirge nach Sachsen kamen. Im Jahr 1117 wird dort erstmals eine Burg „Wolkenburg“ auf dem gleichnamigen Berg erwähnt. Sie wurde als mächtige Burganlage (in Urkunden als fortissimum castrum erwähnt) vom Erzbischof Friedrich von Köln erbaut. Er gab diese Burg als Lehen an eine unbekannte Adelsfamilie, die sich dann „von Wolkenberg“ nannte. Diese Burg hatte zwei Nachteile, zum Einen konnte man von dem Standort aus das Rheintal nicht kontrollieren und zum Anderen lag sie oftmals bis in die Mittagsstunden im Nebel. Aus diesem Grund ließ im Jahre 1138 der Kölner Erzbischof mit dem Bau der Burg Drachenfels beginnen, früher als bisher angenommen. Auch diese Burg gab der den Wolkenburgern als Lehen, die sich aber nach dem neuen Sitz „von Drachenfels“ nannten. Im Jahre 1149 (auch 1160 wird genannt), zog der Erzbischof Arnold I. des Lehen Drachenfels (möglicherweise auch Wolkenburg) ein und gab diese an seinem Protege` den Bonner Stiftsprobst Gerhard von Are. Vermutlich um diese Zeitz suchten sich die Wolkenburger/Drachenfelser neue Herrschaftssitze. Bekannt sind folgende Standorte, die auf die Rheinländische Linie zurückgehen könnten:
- Wolkenburg in Klein-Berßen im Emsland
- Drachenfels in den Vogesen südwestlich von Straßbourg
- Drachenfels im Haardtwald bei Busenberg, nahe Pimasens
- Wolkenburg in Sachsen
- Drachenfels in Sachsen
- Rasephas, heute Ortsteil von Altenburg
- Die Wolkenburger Linie (Livländsiche Linie) im ehem. Ostpreußen
- Die Drachenfelser Linie (Livländische Linie) im ehem. Ostpreußen.
Die Wolkenburger wie auch die Drachenfelser hatten im 13./14. Jahrhundert höchste Ämter im Deutschen Ritterorden inne, u.a. Oberster Trappier (Verantwortlich für die Kliederkammer des Ordens) bzw. Oberster Kumpan (Privatsekretär des Hochmeisters des Deutschen Ritterordens).
Die Herkunft lässt sich auch anhand eines mittelalterlichen Grabdenkmals in Ostpreußen belegen, auf dem steht:
„Herr Phillip von Drachenfels…..hatte zum Vater den Wohlgeborn Herrn Walter von Drachenfels. Sein Großvater Herr Heinrich von Drachenfels so beym Fluß Rheine in Deutschland liegt, herstammte. Der Stammsitz könnte die Burg Rhein (heute polnisch Ryn) in Masuren gewesen sein, weitere Orte wie Wolken, Rheinshof oder Reinwein liegen in der Nähe, auch das „Vorwerk Drachenfels“ fehlt dort nicht (siehe Abb. im Museum Ryn). Vermutlich um 1160 bis 1170 siedelten sich die Wolkenburger/Drachenfelser hier in der Region an. Die Drachenfelser werden in einer Urkunde vom 20.März 1212 erstmals urkundlich genannt. Bereits im Jahre 1170 taucht aber schon der erste Rasephaser auf (Heinrich von Rosewaz), als das Altenburger Bergerkloster in Anwesenheit von Kaiser Friedrich I (Barbarossa) geweiht wurde. Ob dieser v. Rasephas bereits ein Abkömmling der Drachenfelser war, oder ob diese erst später dort einheirateten, ist nicht bekannt. Die verwandtschaftlichen Verhältnisse belegen u.a. Urkunden aus dem Jahr 1289. Die Burg Drachenfels hier an der Zwickauer Mulde könnte etwa um 1165 bis 1170 errichtet worden sein. Im Gegensatz zu Wolkenburg, das sich als Grundherrschaft entwickelt hatte, war Drachenfels immer eine kleine Waldburg, Sitz einer Grundherrschaft war sie nie. Dies stellte schon der Heimatforscher Beil fest, der um 1900 Ausgrabungen am Drachenfelsplateau vornahm. „Die räumliche Enge des Plateaus bot lediglich Platz für einen Bergfried, ein Wohn- und einige Nebengebäude“ so Beil. Wie die Ausgrabungen ergaben, war die Burg durch einen Brand zerstört worden, verglaste Ziegel und Mauersteine beweisen dies. Ob die Zerstörung bewusst erfolgte, oder aber infolge Fahrlässigkeit passierte, kann nicht belegt werden. Wie Bodenfunde beweisen, könnte die Anlage bestenfalls bis etwa 1350 existiert haben. Möglicherweise waren die katastrophalen Witterungsverhältnisse in der ersten Hälfte der 14. Jahrhundert der Grund, dass sich die Drachenfelser der Wegelagerei ergaben und die Burg absichtlich zerstört wurde (Ein Historiker spricht von einem „Horrorkabinett der Witterung“ in dieser ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts). Urkunden aus den Jahren 1289/1290 werden oft als „Beweis“ angeführt, dass die Burg Drachenfels um diese Zeit nicht mehr existiert hätte und die Drachenfelser nur noch Streubesitz im Altenburgischen besessen hätten. Dies geht aber auf eine Fehlinterpretation dieser Urkunden zurück. In den Urkunden von 1289 leisten nämlich die Drachenfelser als Mitbelehnte der Rasephaser ledglich „förmlichen Verzicht“ auf Besitz, den die mit ihnen verwandten Rasephaser ohne ihre Zustimmung bereits um 1216 an das Altenburger Bergerkloster abgegeben hatten.
Als maximale Zeitdauer der Existenz der Burg Drachenfels kann man damit die Jahre zwischen 1170 und 1330 annehmen.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 19. Dezember 2019 -
Neuigkeiten zur “Pleißaer Maschinenfabrik”
Neuigkeiten zur “Pleißaer Maschinenfabrik”
Gisella Rothe
Im “Stadtspiegel” vom 30. Januar 2014 druckten wir den Aufruf von Gisella Rothe mit der Suche nach Zeitzeugen, die etwas über die ehemalige Firma ihres Großvaters Erwin Rothe wissen, ab. In diesem Jahr erreichte uns nun dieser Brief von ihr, den wir gerne passend zum Firmenjubiläum der ehemaligen “Pleißaer Maschinenfabrik” im November abdrucken möchten:
Nach dem erfolgreichen Abschluß der Chronik über die „Pleißaer Maschinenfabrik" (PMF) ist es mir ein großes Anliegen, meiner Freude und meinem Dank für die Hilfe und Unterstützung bei der Erstellung allen Hinweisgebern aus Limbach und Umgebung Ausdruck zu verleihen.
Mein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle natürlich Frank Winter (Mitarbeiter des Esche-Museums), mit dem ich jahrelang einen intensiven, respektvollen und zielführenden Kontakt hatte. Auch von Christian Kirchner vom Stadtarchiv erhielt ich wertvolles Wissen in Form von Puzzle-Teilen. Im Sommer 2016 war das gemeinsame „Werk" soweit vollendet, auch wenn es möglicherweise noch den einen oder anderen kleinen Schatz zu heben gäbe.
In diesem Frühjahr 2019 benachrichtigte mich Herr Winter überraschend darüber, dass es nunmehr im Esche-Museum ab März bis Juni 2019 eine Sonderausstellung über die früheren Nähmaschinenfabriken in Limbach und Umgebung gab. Er schickte mir Fotos über die Platzierung und Umsetzung der Darstellung der PMF und damit sind meine Familie und ich unglaublich stolz und erfreut! Was für eine Auszeichnung für die jahrelange Mühe und Arbeit, quasi von Beginn an bei fast null zu einer kleinen Krone der Ehre und des Andenkens für diese Firma, die am 5. November 2019 ihr 100-jähriges Bestehen hätte feiern können.
Mein Großvater wäre sicherlich ebenso erfreut und würde verhalten schmunzeln. Immerhin erlebte er 1969 sein 50-jähriges Jubiläum, was auf einem vorhanden Foto festgehalten ist.
Nochmals vielen herzlichen Dank und freundliche Grüße aus Hessen nach Sachsen, besonders an die hilfreichen Mitarbeiter des Esche-Museums für die Umsetzung der Ausstellung. Für uns ging ein großer Wunsch in Erfüllung nach dem Motto: “Was sehr lange währt, das wird auch sehr gut”!
Mein Forschungsdrang in Richtung meines Großvaters dauert an. Bisher konnteich leider seinen Werdegang vor seinen Eintritt in die PMF 1919 noch nicht ausreichend beleuchten, z.B. wo und bei wem machte er seine Lehre wahrscheinlich als Mechaniker/Feinmechaniker im Raum Limbach?
Und auch über seine Zeit als Grenadier (Garderegiment) im Regiment Nr. 101 „Kaiser Wilhelm, König von Preußen" stationiert in Dresden während des 1. Weltkrieges sind bisher alle Archivanfragen noch nicht erfolgreich gewesen. So besitze ich vorläufig lediglich ein wunderbares Foto was Erwin Rothe in Gardeuniform einschließlich Helm mit Roßhaarschwanz zeigt und ein Buch ,,Erinnerungsblätter deutscher Regimenter, Heft 14, der sächsischen Armee über das besagte 2. Grenadier-Regiment Nr. 101 nach den Kriegstagebüchern, worin allerdings nur die gefallenen Soldaten und die Einsatzpläne und Wege geschildert werden. Und glücklicherweise hat mein Großvater diesen Krieg ja überlebt. Vielleicht gibt es unter der Leserschaft eine Person, die mir diesbezüglich einen Impuls geben könnte.
Gisella Rothe
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 7. November 2019 -
Die letzte Hinrichtung in Limbach – 1807
Die letzte Hinrichtung in Limbach – 1807
Paul Fritzsching/Hermann Schnurrbusch
Am Anfang des 19. Jahrhunderts war der Gutsbezirk eine Einheit, eine Art kommunaler Gebietskörperschaft, die vom Gutsherrn allein verwaltet wurde mit allen öffentlichen Rechten und Pflichten. Eine „politische Dorfgemeinde“ mit entsprechender Gemeinde-vertretung (Gemeinderat, -vorsteher) entstand in Sachsen erst nach Einführung der Landgemeindeordnung von 1838. Vorher gab es eine Kirch- und Schulgemeinde, für die der Gutsherr das Patronat (Schutzherrschaft) ausübte, das heißt, er entschied in Personal-fragen mit oder hatte die Baulast zu tragen. Der Grundherr war gleichzeitig auch der Gerichtsherr. Für die Ausübung des Patrimonialgerichts[1] hatte der Limbacher Gerichtsherr schon um 1700 juristisch sachkundige Gerichtshalter oder Gerichtsdirektoren heran-gezogen. Erst 1855 zog das Königreich Sachsen die Gerichtsbarkeit an sich und hob die Patrimonialgerichtsbarkeit auf. Der Rittergutsbesitzer Rhöden gab schon 1851 freiwillig die Gerichtsbarkeit ab und Limbach bekam ein Königliches Amtsgericht, heute das Haus Jägerstraße 2 A. Am 27.Mai 1805 wurde dem Gerichtsdirektor Gottlieb August Seyffarth des Gräflich Wallwitzschen Gerichtes in Limbach angezeigt, dass der etwa zehnjährige Christian August Bonitz bei seinem Vormund Johann Gottlieb Müller in Köthensdorf[2] nach heftigem Erbrechen verstorben sei, nachdem er vorher bei seinem Schwager gewesen war. Es bestünde der Verdacht einer Vergiftung. Verdächtigt wurden nun der Schwager des Toten, der 31-jährige Strumpfwirker Thomas Gottlob Schellenberger aus Chemnitz und die leibliche Mutter des Jungen und Schwiegermutter des Schellenbergers, die 53-jährige Hebamme Eva Elisabeth Bonitz[3].
Die Sache wurde in Chemnitz durch die Stadtgerichte untersucht – zuständig für Schellen-berger – die Bonitzin kam in Limbach vor Gericht. Guts- und Gerichtsherr war der Reichs-graf George Reinhold von Wallwitz, der Bruder der verstorbenen Helena Dorothea von Schönberg. Die Kindsleiche wurde seziert und im Mageninhalt Arsenik festgestellt. Schellenberg versuchte, sich im Gefängnis umzubringen, war dann aber bei „gehöriger Befragung“ geständig wie auch seine Schwiegermutter. Es wurde offenbar, dass der Giftmord gemeinsam geplant war mit dem Ziel, an das väterliche Erbteil des Knaben zu kommen, das aus mehreren hundert Talern bestand. Wie sich herausstellte, hatte die Hebamme das Gift noch übrig von der bisher unentdeckten Vergiftung ihres Ehemannes fünf Jahre vorher. Zwischen der Bonitzin und ihrem Schwiegersohn bestand eine sexuelle Beziehung, in den Akten „Unzucht“ genannt. Die Bonitzin hatte „die Vergiftung ihres Sohnes mit ihrem Schwiegersohn Schellenberger verabredet und letzterem ... Arsenik zur Vergiftung ihres Sohnes gegeben“, das der dem Jungen in Branntwein verabreichte. Der Sachverhalt wurde der Leipziger Juristenfakultät vorgelegt und die bestätigte die Todesstrafe, bei Schellenberger durch das Schwert, bei der Bonitzin durch das Rad.[4]
Bevor die Strafe vollstreckt wurde, hatten die Missetäter das Recht, „Defensionen“[5] als eine Art Berufung einzulegen, die zu nochmaliger Anhörung und Überprüfung des Urteils führten. Allerdings blieb auch nach insgesamt dreimaliger Defension beider Inquisiten (Angeschuldigten) und Prüfung durch die Schöppen in Leipzig und die Juristen-Fakultät in Wittenberg das Urteil bestehen. In einem Schreiben an den König bat die Stadt Chemnitz um Milderung des Urteils wegen der Kosten der Hinrichtung, wegen des Volksauflaufes und wegen des Durchzugs fremder Truppen.
Inzwischen waren zwei Jahre seit dem Mord vergangen. Am 20. April 1807 schreibt Friedrich August, von Gottes Gnaden König von Sachsen, und wandelt das Urteil des Räderns bei der Bonitzin in die Strafe der Enthauptung mit dem Schwert um.
Am Urteil bei Schellenberger ändert sich nichts. Die Chemnitzer Superintendentur weist den Limbacher Ortspfarrer Gilbert[1] an, die verurteilte Hebamme „in des Gerichtsfrohns Stube“ täglich zu besuchen, er solle „sie zu ihrem Tode gehörig vorbereiten und (ihr) das Abendmahl reichen.“ Desgleichen sollte der Pfarrer am Sonntag vor der Hinrichtung „zur Warnung vor Begehung dergleichen Schandtaten das Nötige von der Kanzel erinnern.“
Am 12. Juni 1807 fand die Hinrichtung statt. Der Bonitzin wurde ihre Verbrechen verlesen und sie bekannte ihre Taten noch einmal. Die hiesigen Gerichtspersonen und der Verur-teilten früherer Beichtvater, Pfarrer Mäusel aus Taura, begleiteten die Unglückliche auf ihrem letzten Weg. Von der Kirche bimmelte das Totenglöcklein. Schon am Vorabend hatten sich die ersten Neugierigen aus nah und fern eingefunden. Menschenmassen standen zu Tausenden am Wege und stießen Verwünschungen aus, als die Verurteilte von der Fronfeste zum Richtplatz am Galgenhügel[2] geführt wurde. Dort wurde ihr das Urteil nochmals verlesen, der Richter brach den Stab über ihr und übergab sie dem Henker. Nach einem letzten Gebet wurden der Sünderin die Augen verbunden. Dann setzte man sie auf einen Schemel und der Scharfrichter aus Penig schlug ihr mit dem Richtschwert mit einem Hieb den Kopf ab. Der Henker fragte: „Habe ich recht gerichtet?“ Die Antwort war: „Du hast recht gerichtet!“ Dann brachen die Henkersknechte der Toten die Knochen und flochten sie auf das Rad, das hoch am Galgen befestigt wurde – den Raben zum Fraß und den Menschen zur Abschreckung.
Im Schreiben vom 13. Juni 1807 aus Limbach an den König steht: „Die Strafe wurde vollstreckt. Sie wurde mit dem Schwert vom Leben zum Tode gestraft, aufs Rad gelegt und geflochten.[3]“ In einem Gesuch bitten die Limbacher am 17. Juni 1807 darum, den aufs Rad gelegten Körper abnehmen zu dürfen wegen des Gestankes, den er bei der Hitze verbreiten würde. Darauf wurde entschieden, dass der Körper abgenommen und an Ort und Stelle verscharrt werden solle. Der Kopf jedoch sollte zur Abschre-ckung weiter auf dem Rad ver-bleiben. Danach fanden in Limbach keine Hinrichtungen mehr statt.
Am 7. August 1807 wurde auch der Mörder Schellenberger auf dem Marktplatz in Chemnitz geköpft. Tau-sende hatten sich eingefunden, um dem grausigen Schauspiel beizu-wohnen. Ein Chemnitzer Augenzeuge hat das Spektakel detailliert beschrieben.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 26. September 2019 -
Die Zwillingslinden oder „Vereinte Schwestern“ in Rußdorf
Die Zwillingslinden oder „Vereinte Schwestern“ in Rußdorf
Friedemann Maisch im Auftrag des Fördervereins Esche Museum
Die Bäume gehörten zum Gutsbesitz und Vierseitenhof der Rußdorfer Familie Uhle, Waldenburger Str. 169. Durch einen Vorfahr und Naturfreund der Uhles wurde diese Zwillingslinde Mitte des 19. Jahrhunderts als botanische Seltenheit aus einer Idee heraus geschaffen. An den beiden nebeneinander stehenden Linden wurden zwei zufällig gegenüber liegende Äste abgeschnitten und so zusammengefügt, dass ähnlich wie beim Obstbaum eine Veredlungsstelle entstand. Diese Schnittstellen wuchsen erstaunlicherweise zusammen und die beiden Linden wurden immer stärker, wobei die Vereinigungsstelle mitwuchs. Das war eine seltene Laune der Natur. Bis dann aus den beiden Linden allmählich ein mächtiger Doppelbaum wurde.
Mitte der 1920er Jahre war die Verbindungsstelle bereits 30 cm stark geworden und die Stämme hatten einen Umfang von je 1,90 Meter. Auf dem Foto von 1938 ist der Zwillingsbaum deutlich im Hintergrund zu sehen, im Vordergrund steht im Hauseingang die Bauernfamilie Uhle. Das Foto wurde vom Altenburger Besuch des Bauern gemacht, denn kein Bauer hatte damals einen Fotoapparat. Das zweite aber deutlichere Foto stammt aus dem Jahre 1936. Die doppelte Linde war als Laune der Natur den Bürgern im Limbacher Land allgemein bekannt. Eine Windhose riss im Sommer 1945 einen Stamm über der Veredlungsstelle ab, aber der andere Baum wuchs wie unbeeindruckt weiter. Das hatte mir die Bäuerin Frau Rita Wolf geb. Uhle als Zeitzeugin erzählt. Vor dem Bau der Bus-Wendeschleife an der Waldenburger Straße im Jahre 1974 war noch dieser eine Baum vital und auch der Verbindungsbogen, d.h. die Veredlungsstelle mit dem Zwillingsbaum war vorhanden. Die Linde war beim Straßenbau im Weg und fiel leider dem Bau der Bus-Wendeschleife zum Opfer.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 29. August 2019 -
Meine Erinnerungen an die „Knaumühle“ im Frühjahr 1945
Meine Erinnerungen an die „Knaumühle“ im Frühjahr 1945
Dr. Walter Siegert
Ich bin 1929 in Siegmar geboren und in Erfenschlag habe ich Kindheit und Jugend erlebt. Im Februar und März 1945 wurde Erfenschlag durch Bombenangriffe fast völlig zerstört. Das war eine furchtbare Erfahrung. Es gab viele Tote und schreckliche Szenen, wo ganze Familien unter den Trümmern ihrer Häuser zu Tode kamen. Das alles erlebte ich als knapp 16-jähriger Oberschüler. Wir wurden vom Bürgermeister zu Aufräumarbeiten und auch zum Bergen der Blindgänger eingesetzt. Das erfolgte unter Anleitung von Wehrmachtsangehörigen, zum Teil gemeinsam mit KZ-Häftlingen.
Im März kam dann eine Aufforderung, die mich nach Limbach in die „Knaumühle“ führte. Das war praktisch eine Art „Gestellungsbefehl“. Dem konnte man nicht ausweichen. Mein Vater - ein Mann der den ganzen Ersten Weltkrieg durchhalten musste - riet mir, dieser Aufforderung zu folgen. Etwa am 20. März 1945 machte ich mich auf den Weg. Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Limbach kam. Wahrscheinlich mit der Bahn. In der „Knaumühle“ war alles für uns hergerichtet. Im Saal dreistöckige Betten, am Rande Spinde für die zivilen Sachen. Wir wurden dort von Wehrmachtsangehörigen in Empfang genommen. Sie kamen aus einem nahegelegenen Lazarett. Jeder hatte Verwundungen. Der Kompaniechef, ein Hauptsturmführer der Waffen-SS, hatte ein Auge verloren. Unser „Spieß“ ein Feldwebel, hatte nur noch einen Arm. Es war das letzte Aufgebot! Wir wurden eingekleidet: es waren belgische Beuteuniformen „khakibraun“, Wickelgamaschen, hohe Schuhe. Am Arm trugen wir eine Armbinde, auf der nach meiner Erinnerung „Wehrmacht und ein Adler“ gedruckt waren. Das alles nahm man einfach so hin - nicht ohne Spaß, als wir uns in diesem „Kostüm“ so gegenüber standen. Als Waffe bekamen wir eine Karabiner 98 - noch das lange Vorkriegsmodell. Wir wurden „vergattert“ und mit markigen Worten auf den Dienst eingestimmt. Über dem Ganzen lag eine grude Stimmung.
Die Ausbildung begann unverzüglich. Sie fand vor allem in einem in der Nähe liegenden Wald und einem ehemaligen Steinbruch statt. Wir waren jung und die körperlichen Anstrengungen hielten sich in Grenzen. Ab und zu schien die Frühlingssonne. Die Verpflegung war ganz gut. Und die Vorgesetzten gingen mit uns halbwegs menschlich um. Der ganze Tag verging mit Geländeübungen und Waffenausbildung, einschließlich scharfer Munition, Handgranaten und Panzerfaust. Das war alles höchst gefährlich. Aber es war - so seltsam es klingt - für uns junge Kerle auch irgendwie spannend. Zum anderen war es noch immer „Übung“, der „Feind“ war noch „weit weg“. Aber seine Artillerie hörte man schon. Über den näher kommenden „Feind“, die Russen aus Richtung Ost, die Amerikaner aus Richtung West, erfuhren wir gar nichts. Das Signal für die näher rückende Front war der zunehmend lautere Donner der Geschütze und die immer häufiger auftauchenden Tiefflieger. Die letzteren kamen uns immer öfter während der Ausbildung nahe, zum Teil auch mit Beschuss in Richtung des Waldstücks, wo wir uns in Löchern eingegraben hatten. Einmal spritzten die Geschosse durch die dicken Bäume. Der Ernstfall kam gewissermaßen näher! Und unter uns kursierte die ängstliche Frage, wann kommt das erste „Gefecht“ direkt auf uns zu. Denn es war inzwischen etwa Mitte April und die Fronten rückten von Ost und West immer näher.
Plötzlich wurden wir eines Nachts geweckt und marschierten - ohne Waffen - über ein Feld Richtung einer Bahnlinie. Dort stand ein Lazarettzug. Unsere Aufgabe war, Verwundete die dort einfach auf freiem Feld ausgeladen wurden, auf ihren Tragen zu einem naheliegenden Weg zu schleppen, wo Pferdewagen den weiteren Transport zu einem Krankenhaus übernahmen. Es war eine kalte Frühlingsnacht, mattes Licht drang aus den Fenstern des Lazarettzuges, Stöhnen der Verwundeten … eine schlimme Erfahrung. Am Rande des Feldes wurden jene Tragen abgestellt, auf denen verstorbene Soldaten lagen. Ich hatte das nicht sofort erkannt und fragte besorgt: Das ist doch zu kalt für die Verwundeten, wenn sie so auf dem Feld stehen. Die Antwort war für mich ein Schock, ich will sie nicht wiederholen. Dieser Nachteinsatz wiederholte sich nach meiner Erinnerung noch mehrmals.
An einem Freitag gegen Ende April passierte dann Folgendes: Es gab einen Kompanieappell und der Hauptsturmführer und Kompaniechef sagte uns, wir sollten unsere Uniformen abgeben und das Wochenende zu Hause verbringen. Man würde uns rufen, wenn wir wieder gebraucht würden. Wir nahmen das so, wie es gesagt wurde und nach etwa einer Stunde waren wir auf dem Heimweg. Es ging nur zu Fuß, so erinnere ich mich. Erstmal bis nach Siegmar zur Tante und dann heim nach Erfenschlag. Es war für uns eine Chance, die sich uns dank anständiger Offiziere bot, die uns nicht „verheizen“ wollten, wie das in diesen Tagen überall geschah. Später habe ich von meinem Limbacher Schulkameraden Heinz Voit erfahren, dass sich Offiziere dort in der Nähe erschossen haben. Ich nehme an, es waren jene, die uns jungen Leuten faktisch das Leben geschenkt haben.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 15. August 2019 -
Die Hanneloreneiche am Friesenweg
Die Hanneloreneiche am Friesenweg
Fridemann Maisch
Im Fundus des Esche-Museums konnte ein altes Diapositiv, wahrscheinlich aus der Mitte der 1920er Jahre mit der Darstellung dieses Bilderbuchbaumes aufgefunden werden (Foto oben). Vom Baumbestand des ehemaligen Oesterholzes, dort wo der Baum zu finden ist, war schon lange keine Spur mehr vorhanden. Man erkennt im Hintergrund auf dem Diapositiv deutlich die beginnende Bebauung der Burgstädter Straße. Die Eiche auf dem Dia steht natürlich im Vordergrund. Es ist eine über die Generationen weitergegebene Legende und Überlieferung, dass dort einstmals von den freien Bauern unter der Baumkrone nach germanischer Sitte „Rat und Gericht“ gehalten wurde und dass deshalb die Eiche von Rodungen verschont blieb. Deshalb wurde ihr ein Alter von mindestens 800 Jahren angedichtet, was aber so nicht stimmt. Der zum Rittergut gehörende Wald das Oesterholz wurde in den Jahren nach dem 1. Weltkrieg von der ehemals kriegsbegeisterten, jetzt aber frierenden und hungernden Limbacher Bevölkerung vollständig abgeholzt, nachdem schon vorher der Wald an der Eiche zurückgewichen war. Dem harten Eichenholz konnten Säge und Axt offenbar widerstehen oder man scheute sich diesen symbolhaften Baumriesen zu fällen. Auch eine mit Bänken umstandene unweit befindliche mächtige Buche, der sog. „Börsenstammtisch“, ein beliebter sommerlicher Treffpunkt von Handwerksmeistern, wurde schon in der frühen Kaiserzeit abgeholzt. Das Gelände des ehemaligen Oesterholzes wurde dann ab den 1920er Jahren zum Teil als Schuttabladeplatz benutzt. Im östlichen Teil entstand der Sportplatz und dann in den 30er Jahren die Eigenheimsiedlung. Früher gehörte die Flur des Oesterholzes dem Rittergut und heute gehört das Gelände der Stadt. Die Hanneloreneiche war schon 1930 die schönste und mächtigste Eiche weit und breit. Das Alter des Baumriesen wurde 1992 von Sachverständigen auf ca. 400 Jahre geschätzt. Eine weitere aber stichhaltige Vermutung ist, dass die Hanneloreneiche nach der auf dem Limbacher Rittergut lebenden Edelfrau Hannelore benannt war. Die Adlige hieß eigentlich Johanne Eleonore von Einsiedel, war Witwe, lebte von 1732 bis 1742 auf dem Rittergut und betreute die Töchter des verwitweten Schwagers Antonius III. von Schönberg. Damals soll es neben der Eiche eine Quelle und einen kleinen Teich gegeben haben. Offenbar hielt sich dort an diesem idyllischen Ort des Öfteren Hannelore mit den Töchtern des Gutsherren auf. Mitte der 1920er Jahre betrug der Umfang des Bilderbuchbaumes bereits 4,50 Meter und im Jahre 2010 konnte der Umfang des Stammes mit respektablen 5,52 Meter gemessen werden. Im oberen Kronenbereich ist seit Jahren Wipfeldürre und Totholz vorhanden, ein Merkmal alter Baumriesen. Die Lehrer führten früher oft Schulklassen zur Hanneloreneiche und die Kinder umfassten in einer lebenden Kette den mächtigen Stamm. Unter der Eiche liegt auf dem Wurzelwerk heute ein großer Stein. Auf dem Diapositiv vom Chronist Fritsching aus den 1920er Jahren ist dieser riesige Brocken nicht vorhanden. Es ist sicherlich so, dass in den 1930er Jahren Heimattümler einen kleineren Stein als Gerichts-oder Opferstein dort platziert hatten, um an den von den Nazis gepflegten fragwürdigen germanische Ahnenkult bzw. an die nordische Mythologie anzuknüpfen. Phantasten sahen darauf auch schon Odins Raben sitzen. Zu Beginn der 90er Jahre wurde dieser Stein gegen einen wesentlich größeren ausgewechselt, welchen man bei der Errichtung der Eigenheime an der Oberfrohnaer Hauptstraße in einer Baugrube fand. Die zuständige Aufsichtsbehörde, das Landratsamt sollte überlegen, diesen riesigen Brocken, der das Wurzelwerk unzulässig belastet, bald wieder entfernt wird. Heute gehört die Hanneloreneiche zu den schönsten und mächtigsten Eichen im weiten Umkreis und sie wurde bereits seit den 1930er Jahren unter Naturschutz gestellt. Sie ist wegen ihres Alters und Stattlichkeit ein Naturdenkmal allerersten Ranges. Das Eulenschild wurde bereits in der DDR-Zeit angebracht. Die Stadt Limbach-Oberfrohna sollte stolz sein, so ein prächtiges Naturdenkmal zu besitzen. Sonst ist die Eiche noch kerngesund, im Inneren ist sie natürlich hohl. Das ist bei solchen alten Bäumen nichts außergewöhnliches. Neben dem Baum wurde in den 1990er Jahren von der Stadtverwaltung eine Tafel zur Geschichte und Status der Hanneloreneiche aufgestellt. (Anmerkung der Redaktion: Diese wurde mit Graffiti beschmiert und deshalb durch den Bauhof entfernt. Ein neues Schild ist in Planung) Die nächsten und ähnlich mächtigen Eichen stehen am Stadtrand von Frankenberg und dann unweit die 800-jährige sogenannte Grabeiche in Nöbdenitz bei Schmölln. Die stärkste Eiche Sachsens, die sogenannte Storcheneiche, findet man in Ebersbach bei Zittau, mit einem Stammumfang von 9,50 Meter und einem geschätzten Alter von 800 Jahren. Dann haben wir in Deutschland noch einige mächtige, aber tatsächlich 1000-jährige Eichen. Sie befinden sich in Mecklenburg in einem ehemaligen Hutewald nahe der Ortschaft Ivenack.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 04. Juli 2019 -
Legendäre Bäume im Limbacher Land
Legendäre Bäume im Limbacher Land
Friedemann Maisch
Nun folgt eine etwas gruselige Geschichte zur Galgenlinde in Bräunsdorf. Der Standort der heutigen Galgenlinde ist die frühere gemeinsame Richtstätte von Bräunsdorf und Kaufungen. Der Baum befindet sich einsam auf der Feldflur, die heute im Besitz des Bräunsdorfer Landwirtes Schubert ist. Der Standort der alten Linde ist eine Anhöhe, mitten auf freiem Feld, an der Flurgrenze zu Kaufungen und auf dem Flurstück des ehemaligen „Bergsamelschen Gut“. Ursprünglich stießen dort die Besitzungen des Rittergutes Bräunsdorf mit dem Rittergut Kaufungen aneinander. Der Stammumfang der Galgenlinde betrug im Jahre 2016 - 3,47 Meter. Der Umfang lässt auf einem höchstens 100 bis 120 Jahre alten Baum schließen. In zwei alten Urkunden wurde vom Chronisten Horst Strohbach 1935 folgendes gefunden: Der Galgen wurde zusammen mit dem Nachbardorf Kaufungen benutzt. Ein Pfosten des Galgens stand auf Kaufunger Flur, der andere Pfosten in Bräunsdorf. Das war praktisch, so konnte man sich die Kosten der Hinrichtung teilen. Die Scharfrichter kamen aus Penig und waren dort zugleich Abdecker und Seifensieder. Im Kaufunger Lehnbuch von 1626 steht sinngemäß Folgendes: „Ein Dieb namens Michael Fiedler wurde am 18. Oktober 1626 am Galgen gehängt“. Dem Hingerichteten ließ man zur Abschreckung längere Zeit baumeln - das war in alten und düsteren Zeiten so üblich. Die Raben bedienten sich inzwischen am Leichnam. Nach zwei Jahren wurde das nur noch von Sehnen zusammengehaltene Skelett des „armen Sünders“ von Unbekannten heruntergerissen. Beide Daumen und auch die zum Festmachen des Körpers benutzte eiserne Kette wurden gestohlen. Die Daumen eines Diebes wären nach alten Überlieferungen glücksbringend. Der herbeigerufene Peniger Scharfrichter „verscharrte“ dann die Überreste des unter dem Galgen liegenden Delinquenten an Ort und Stelle. Das Urteil wurde immer vom jeweiligen Feudalherrn ausgesprochen, der zugleich auch Gerichtsherr war. Untere Feudalherren waren damals die Grafen von Einsiedel auf Wolkenburg, als Pächter des Rittergutes Limbach. Der obere Feudalherr war der Graf von Schönburg auf der Rochsburg. In einem alten Kaufbuch von Bräunsdorf finden sich weitere Eintragungen zu Hinrichtungen. 1677 ging es z.B. um Streit zwischen Bräunsdorf und Kaufungen wegen Geldes und um die Bezahlung der Gerichtskosten und des Scharfrichters. Ein des Diebstahls von Silberlöffel Beschuldigter soll vor seiner Hinrichtung eine junge Linde ausgerissen und an der Richtstätte mit der Baumkrone verkehrt eingepflanzt haben. Der arme Sünder sollte gesprochen haben: „So wahr das Bäumchen gedeihen wird, so wahr bin ich unschuldig“ – so die Legende. Es nützte nichts, er wurde trotzdem aufgeknüpft. Die Linde schlug aus und wurde zu einem starken Baum. So entstand die Sage von der legendären Bräunsdorfer Galgenlinde. Im Grundbuch des Amtsgerichtes Limbach für das Flurstück 342 auf dem sich der Galgen befand wurde 1909 der damaligen Besitzerin und Bäuerin Anna Schubert auferlegt, dort die Galgenlinde zu erhalten und gegebenenfalls eine neue Linde zu pflanzen. Das wird die heutige Linde sein - gepflanzt irgendwann in der Kaiserzeit. Veranlasst hatte dies ein Heimat- und Naturfreund aus Chemnitz, wahrscheinlich ein gebürtiger Bräunsdorfer. Er hatte ein großes Interesse am Fortbestand des legendären Baumes und zahlte deshalb laut Grundbucheintrag an die Eigentümer 50 Reichsmark für etwaige Nachpflanzungen. Das war damals eine große Summe, etwa so viel wie ein Monatsverdienst. Es bestand dazu wohl ein Anlass, wahrscheinlich war damals die ursprüngliche Galgenlinde umgestürzt. Die heutige ca. 100 Jahre alte Linde mit einem Stammumfang von 3,47 Meter steht unter Naturschutz und wurde schon in der DDR-Zeit mit einem Eulenschild versehen. Die Linde weist in der Krone einen stärkeren abgestorben Ast auf, der bei Sturm herunter brechen könnte. Unter dem Baum stand bis vor kurzem eine Bank für müde Wanderer. Das Landratsamt lies in vorauseilender Pflichterfüllung diese Bank entfernen, als ob sich gerade bei Sturm dort müde Wanderer ausruhen würden. Vorausschauend auf künftige Sturmschäden pflanzten engagierte Bräunsdorfer 2007 in unmittelbarer Nähe wieder eine junge Galgenlinde. Der alte Baum ist aber nicht die stärkste Linde im Limbacher Land. Die mächtigste Linde finden wir in Bräunsdorf am Vierseitenhof vom Bauer Wilfried Vogel. Sie hat einem Umfang von 5,47 Meter. Apropos Hinrichtungen: In Limbach erfolgte die letzte mittelalterliche und blutige Hinrichtung im Jahre 1807 – so berichtet dies Paul Seidel. Die Giftmörderin Rosina Bonitz wurde inmitten einer großen Zahl von sensationsgierigen Gaffern neben dem Galgen mit dem Schwert enthauptet. Der Scharfrichter kam wie in alten Zeiten üblich aus Penig. Der Körper der Hingerichteten wurde dann auf ein Wagenrad geflochten und bis zur Verwesung längere Zeit dort zur Schau gestellt. Diese schauderhafte Aktion sollte der Abschreckung dienen. Die Richtstätte bzw. der Galgen befand sich an der Kreuzung der heutigen Straße des Friedens und der Goethestraße, an der Flurgrenze Limbachs zu Oberfrohna. Das war für Limbach praktisch, man konnte sich auch die Kosten für die Richtstätte mit Oberfrohna teilen. Weitere Hinrichtungen in L.-O.: Die für die Region beschämende öffentliche Hängung des polnischen Zwangsarbeiters Leon Tobola am 16.4.1941 im Oberfrohnaer Gemeindewald durch die NSDAP und die Hängung russischer Kriegsgefangener im Gefangenenlager gegenüber dem Limbacher Bahnhof durch die deutsche Wehrmacht.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 09. Mai 2019 -
Der Händler mit dem Dreirad
Der Händler mit dem Dreirad
Hans Lange
Früher wurde im Straßenhandel sehr oft Obst und Gemüse angebo-ten. Wer damit seine Familie ernähren wollte, der musste sich schon etwas einfallen lassen, die Rußdorfer drücken das so aus, das sie sagen, der hat was auf dem Kasten. Ein Original seltener Güte und Klasse war in dieser Beziehung der Gaitzsch Kurt aus dem Rußdor-fer Niederdorf. In den DDR-Zeiten war er wohl das absolute Ass der Straßenhändler. Sein wertvollstes Gerät war dabei ein Dreirad, wohl ein Vehikel aus den 1930er Jahren, das immer wieder fahrtüchtig gemacht wurde, wenn auch die Umstände kompliziert waren. Er be-lud das Fahrzeug daheim und meldete sich dann bei seinen Kunden mit einer großen Klingelglocke an. Er schwankte diese mehrmals hin und her. Wenn man ihn schließlich bemerkt hatte, dann schrie er mit gewaltiger Stimme, was er mitgebracht hatte und verkaufen wollte. Seine Spezialangebote erregten die Gemüter, und manchmal bot er auch an, was er gar nicht mithatte. Die Leute strömten zu seinem Dreirad, wenn er Bananen als besondere Rarität angeboten hatte, obwohl sie gar nicht in seinem Angebot waren. Er stritt das dann strikt ab. Wenn er aber erst einmal die Leute an seinem Dreirad hatte, dann ging wirklich niemand, ohne etwas zu kaufen, wenn es auch nur eine Kleinigkeit war. Und das mit den Bananen nahm wohl keiner so richtig übel. Kurt hatte jahrzehntelang eine kranke Frau zu versorgen und zu pflegen. Er war ein richtiger Lebenskünstler. Sein Dreirad aber ist in die Rußdorfer Geschichte eingegangen.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 25. April 2019 -
Zum 90.Geburtstag von Heiner Müller
Zum 90.Geburtstag von Heiner Müller
Hartmut Reinsberg
Am 9. Januar 2019 wäre Heiner Müller 90 Jahre alt geworden. Leider verstarb er bereits mit 66 Jahren am 30. Dezember 1995. Heiner Müller stammte aus dem sächsischen Eppendorf und kam 1933 mit seiner Mutter nach Bräunsdorf und besuchte die Bräunsdorfer Grundschule bis zum Wegzug im Jahr 1938. Seine damaligen Klassenkameraden konnten sich noch gut an ihren Mitschüler Heiner Müller erinnern. Da über die Kindheit des später doch recht bekannten Mannes wenig bekannt war, kam sein Bruder Wolfgang Müller aus Brandenburg auf die Idee, diese Lücke im Leben des Schriftstellers zu schließen. Mit den früheren Mitschülern wurden Kontakte aufgenommen und eine Zusammenkunft in der Bräunsdorfer Schule organsiert. Wolfgang Müller hielt alle die Stationen in der Kindheit seines Bruders in einem Film fest. Es war schon interessant zu erfahren, welch ein bescheidener Junge der spätere bekannte Dramatiker damals war.
Wenig bekannt ist auch, dass im Geburtenregister nicht Heiner, sondern Raymund stand. Aber schon als Kind lehnte er seinen Vornamen ab und nannte sich Heiner, was am Ende auch seine Eltern akzeptierten. Hier zeigte sich schon eine charakterliche Besonderheit, die später sein Wirken bestimmte, indem er prinzipiell seine eigenen Wege beschritt. Zeitgenossen bezeichneten ihn auch als interessanten Querdenker und Intellektuellen, dessen eigensinnige Ansichten immer wieder verblüfften. Sein kritisches Schaffen hat ihm bei den Machthabern nicht gerade beliebt gemacht und er wurde aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen. Aber mit solchen Gegebenheiten konnte er leben und er blieb auch später bei all den Repressalien bei seinen Auffassungen und Ansichten, welche sich in seinen zahlreichen Werken wie beispielsweise „Der Lohndrücker“, „Zement“, „Die Schlacht“, „Die Hamletmaschine“, „Der Auftrag“, „Die Umsiedlerin“ und auch in einer Gedichtsammlung von 1949 bis 1991 widerspiegeln. Er blieb sich in seinem Schaffen mit seiner kritischen und zum Teil auch zynischen, aber auch genialen Sicht der Dinge treu und erntete letztendlich weltweit Erfolge und Anerkennung. Man kann deshalb auch davon ausgehen, dass er in dieser Hinsicht weitestgehend das Schicksal des ebenfalls berühmten Dramatikers Bertolt Brecht teilte. Bemerken möchte ich noch, dass die nach der Wende veröffentlichte Autobiographie „Krieg ohne Schlacht“ zum meistgelesenen Buch des Autors Heiner Müller wurde.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 31. Januar 2019 -
125 Jahre Lutherkirche Oberfrohna
125 Jahre Lutherkirche Oberfrohna
Ursula Kutscha
Ende September feierte die Oberfrohnaer Kirchgemeinde die 125-jährige Kirchweihe. Zu diesem Anlass gab Ursula Kutscha, ehrenamtliche Kirchen- und Friedhofshistorikerin, Einblicke in die Entstehung des Gotteshauses. Sie hat mithilfe der im Kirchenarchiv befindlichen Unterlagen und der „Chronik von Oberfrohna“ vom Pfarrer Päßler Informationen aufbereitet. Im Folgenden finden Sie Auszüge aus ihrem Vortrag, den sie anlässlich des Jubiläums gehalten hat.
Bevor in Oberfrohna an eine eigene Kirche gedacht werden konnte, waren zunächst viele andere Schritte erforderlich. Oberfrohna, eine in den ehemaligen Marktflecken Limbach eingepfarrte Ortschaft, wurde am 1. Januar 1890 mit damals reichlich 3.000 Seelen zu einer selbstständigen Gemeinde erhoben. Die Loslösung von Limbach war bereits seit längerer Zeit – unter anderem aufgrund der ständig wachsenden Bevölkerungszahlen – als notwendig erkannt worden. Die Auspfarrung wurde schließlich am 2. Mai 1889 beschlossen.
Bereits seit 1861/62 fand sich die Gemeinde in Oberfrohna zu Betstunden zusammen, die zunächst im örtlichen Armenhaus und später in der Schule abgehalten wurden. Einen ersten „richtigen“ Gottesdienst konnte man am 1. Januar 1890 feiern, nachdem ein größeres Schulzimmer als Betsaal ausgestattet worden war. Hier fanden etwa 150 Gläubige Platz.
Im Kirchenarchiv findet sich ein dicker Band mit der Bezeichnung „Die Erbauung einer neuen Kirche in Oberfrohna“. Auf Blatt 1 schrieb Pfarrer Hemmann als Aktennotiz: „Nachdem mit dem 1. Januar 1890 die Auspfarrung von Oberfrohna ins Leben getreten, auch die anfänglich geplante Erbauung einer den gottesdienstlichen Zwecken dienenden provisorischen Halle sich als nicht empfehlenswert bewiesen, richtete man sein Augenmerk seitens des Kirchenvorstandes und der Gemeinde immer bestimmter auf den Neubau einer Kirche.“
Ende des Jahres 1890 legte der Dresdner Architekt Christian Schramm eine Skizze für einen Kirchneubau vor. Am 3. Dezember wurde dieser Neubau dann einstimmig beschlossen, am 10. desselben Monats wurde Schramm mit der Ausarbeitung eines Grundrisses beauftragt und am 22. Januar 1891 konnte bezüglich der Glocken verhandelt werden. Zu den nun anstehenden Vorarbeiten gehörte auch die Klärung des Standortes, wofür bereits im Vorjahr ein Grundstück in der Ortsmitte aufgekauft wurde. Die nächste wichtige Frage war die Beschaffung der Finanzen für das Bauvorhaben. Dazu wurde ein Darlehen in Höhe von insgesamt 160.000 Mark aufgenommen, für dessen Tilgung das Landeskonsistorium 14.000 Mark Unterstützung gewährte. Auch die Gemeinde selbst hatte über viele Jahre Gelder gesammelt und beteiligte sich. Für die geliehene Summe war eine Rückzahlungsfrist von 58 Jahren festgelegt worden. Die tatsächlichen Kosten für den Bau beliefen sich am Ende auf 152.644,81 Mark.
Am 1. Juli 1891 wurde mit dem ersten Spatenstich der Bau begonnen, am 17. August der Grundstein gelegt. Anlässlich der Grundsteinlegung bewegte sich ein langer Festzug unter dem Geläut der Schulglocke und dem Gesang des Liedes „Ein feste Burg ist unser Gott“ zu dem geschmückten Bauplatz. Pfarrer Hauptmann betonte in seiner Rede, dass es noch manchen Hammerschlag und Meißelstich kosten würde, bis der Bau ausgeführt wäre und das, was auf Jahrhunderte gegründet und in den Grundstein eingemauert würde, wäre doch einst vergänglich, nur Gottes Wort vergeht nicht. Die eingemauerte Grundsteinurkunde wird auch in späteren Zeiten noch Kenntnis über die Zeit des Kirchbaues geben. Der Hammer, mit dem die Schläge bei der Grundsteinlegung von verschiedenen Persönlichkeiten ausgeführt wurden, befand sich lange Zeit als Erinnerungsstück im Kirchenarchiv. Der Grundstein selbst ist in die Mauer unterhalb des Kanzelfußes eingefügt worden. Bis am 24. September 1893 die feierliche Weihe erfolgen konnte, waren zwei Jahre emsigen Schaffens zu beobachten. Mit Interesse verfolgten die Einwohner der Umgebung das stetige Wachsen der Grundmauern, das Hervortreten der Wandungen und das über dem Bau hervorragende Turmgemäuer. Neun Monate dauerte es, bis das Mauer- und Balkenwerk vom Grund bis zum Dachfirst ausgeführt war. Am 31. Mai 1892 konnte das Erreichen der Giebelhöhe gefeiert werden. Auf zum Teil schwindelerregenden Leitern konnten die Festteilnehmer zum Dachboden hochsteigen. Am Bau waren damals drei Poliere, ein Bauschreiber, 41 Maurer, 25 Handarbeiter, zehn Zimmerleute, sechs Steinmetze und zwei Geschirrführer beteiligt.
Mit einer schlichten, ergreifenden Andacht wohnten mehrere Kirchvorsteher und Gemeindemitglieder am 24. März 1892 dem Guss der Glocken in der Bierlingschen Gießerei in Dresden bei. Mit einem Gebet bat Pfarrer Hauptmann um den Segen zum Gelingen des Gusses. Die vortrefflich gelungenen Glocken kosteten inklusive Gestühl und Transport 10.800 Mark und hatten ein Gesamtgewicht von 4.145,5 Kilogramm.
Am 11. April 1893 wurde das Geläut mit einem stattlichen Festzug eingeholt und zu ihrer Weihe geleitet. Es muss ein wahrhaft prächtiges Bild gewesen sein: Acht Vorreiter eröffneten den Zug und zahlreiche Teilnehmer aus den verschiedensten Bereichen begleiteten die geschmückten Glocken zum Gotteshaus, wo der damalige Chemnitzer Superintendent Professor Michael das Weihegebet sprach. Nach dem Aufzug der Kirchenglocken – in mehrstündiger mühsamer Arbeit – konnte an jenem denkwürdigen Tage abends zum ersten Mal eine Stunde lang das Geläut von der neuen Kirche erklingen.
Der Kirchweihe am Sonntag, dem 24. September 1893, waren viele Vorbereitungen in allen Kreisen der Gemeinde vorangegangen. Am Sonntag davor hatte die Kirchgemeinde einen bewegten Abschiedsgottesdienst im Betsaal gefeiert.
Nun war endlich der ersehnte Tag gekommen und die Gemeinde Oberfrohna konnte ihr schönes und stolz aufragendes Gotteshaus in Gebrauch nehmen. Wiederum war ein langer Festzug zusammengestellt worden. Um 8:30 Uhr riefen mit vollem Klang die Glocken zum ersten Gottesdienst der neuen geistigen Heimstatt in Oberfrohna. Unter den Klängen der Luther-Weise „Ein feste Burg ist unser Gott“ setzte sich der lange Zug in Bewegung durch den festlich geschmückten Ort, hinauf zum Kirchberg, stellte sich vor dem reicht geschmückten Gotteshause auf und stimmte mit Begeisterung den Liedvers „Tut mir auf die schöne Pforte“ an. Darauf übergab Architekt Schramm den feingearbeiteten Kirchenschlüssel an den Vertreter des Kirchenregiments und dieser wiederum überreichte ihn an den Superintendenten Professor Michael, welcher ihn nun an Pfarrer Hauptmann übergab. Der Geistliche der Lutherkirche Oberfrohna öffnete das Kirchentor und langsam zog die Gemeinde in ihr schönes Gotteshaus ein.
Bei einem gemeinsamen Mittagessen der kirchlichen Vertreter und geladener Gäste wurde unter anderem auch die engagierte Arbeit von Pfarrer Hauptmann hervorgehoben, von dem der Architekt Schramm meinte, „die halbe Kirche hat der Pastor gebaut“. Dieser junge Geistliche hat seine ganze Kraft für den Aufbau seiner Gemeinde und die Durchsetzung der geplanten Vorhaben derart engagiert eingesetzt, dass er bald schon aus gesundheitlichen Gründen aus dem Dienst ausscheiden musste.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 17. Januar 2019 -
Anmerkungen zur Limbacher Schachgeschichte
Anmerkungen zur Limbacher Schachgeschichte
Rüdiger Hähle
Am 31. Oktober 1885 wurde in Limbach der Erzgebirgisch-Vogtländische Schachbund gegründet. In diesem Rahmen fand ein großes Schachturnier statt, über welches das Limbacher Tageblatt berichtete. Daran nahmen 47 Schachfreunde aus Limbach und 11 weiteren Orten teil. Bereits in der Frühphase der Arbeiterschachbewegung entstand im Oktober 1911 ein Arbeiterschachklub, der in seinen besten Zeiten um die 30 Mitglieder zählte. In den 1960er Jahren hatte die BSG Motor Limbach-Oberfrohna mit Christian Steudtmann (im Bild) einen wahren Schachkönner. Er ging 1971 nach Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, um in der dortigen Spitzenmannschaft zu spielen. Sein neunmaliger Gewinn der Bezirkseinzelmeisterschaft von Karl-Marx-Stadt ist nicht annähernd erreicht worden. Christian konnte zweimal an der Endrunde zur DDR-Einzelmeisterschaft teilnehmen und in seiner Laufbahn mehrere Schachgroßmeister bezwingen. Im März 2018 ist der vielleicht bisher stärkste Limbacher Schachspieler 73-jährig gestorben.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 8. November 2018 -
Gert Hofmann zum 25. Todestag
Gert Hofmann zum 25. Todestag
Dr. Andreas Eichler
Aus Anlass des 25. Todestages von Gert Hofmann veröffentlichen wir einen Beitrag von Andreas Eichler, Gründungsmitglied des Freundeskreises Gert Hofmann und Geschäftsführer des Niederfrohna Mironde Verlages. Der komplette Text ist unter www.mironde.com/litterata nachzulesen. Gert Hofmann ist vor allem durch seinen Roman „Der Kinoerzähler“ berühmt geworden, der mit Armin Müller-Stahl in der Hauptrolle verfilmt wurde.
Am 1. Juli 1993 verstarb der deutsche Dichter Gert Hofmann, einer der meistübersetzten Schriftsteller der 1960 bis 1990er Jahre, in Erding bei München. Er wurde am 29. Januar 1931 in Limbach geboren. Nach dem Besuch der Leipziger Sprachschule und einem Studienjahr in Leipzig ging er nach Freiburg im Breisgau. Dort formulierte Hofmann innerhalb weniger Wochen sein literarisches Selbstverständnis als Dissertationsschrift unter dem lapidaren Titel „Interpretationsprobleme zu Henry James“. Nach Hofmanns Erfahrungen war es schon längere Zeit nicht mehr möglich, einen Roman im klassischen Sinne zu schreiben. „Heute wird alles als Roman bezeichnet, was garantiert keiner ist“ (Thomas Mann). Hofmann hob deshalb den Prozess der Dramatisierung des Romans bei James heraus. Der Roman als „abgeschlossene Darstellung einer abgeschlossenen Epoche“ ist für James nicht mehr möglich. „Dramatisierung“ meint hier die Anwendung der Mittel des Dramas auf die Epik, das heißt die Vergegenwärtigung von Geschichte in unserem Kopf. Die Mehrdeutigkeit der Sprache soll dem Leser leichter Assoziationen und Vergegenwärtigung ermöglichen. Der Schriftsteller ist hier ein Sprachschöpfer.
In der Dramatik sah Hofmann seine Berufung. So konzentrierte sich Gert Hofmann auf Hörstücke, Hörspiele, Fernsehspiele und Theaterstücke. In den Jahren 1960 bis 1992 wurden 43 Hörspiele Gert Hofmanns von deutschen und internationalen Radiosendern zum Teil mehrfach produziert und gesendet, sieben Theaterstücke aufgeführt und vier Fernsehspiele gesendet. Das erste eigenständige Hörspiel Gert Hofmanns, „Die Beiden aus Verona“, inszenierte und sendete der Bayerische Rundfunk 1960.
Am 7. Februar 1961 fand die Premiere von Hofmanns erstem Theaterstücks „Advokat Pathelin“ am Freiburger Wallgrabentheater statt. Am 23. Januar 1963 ging in Bristol die Uraufführung seines zweiten Theaterstückes „The Borgemaster“ (Der Bürgermeister) über die Bühne. Stefanie Hunzinger von S. Fischer, die Gert Hofmanns Publikationen betreute, war sowohl in Freiburg als auch in Bristol bei den Premieren zugegen. Im Lauf der Jahre 1963/64 spielten Bühnen in ganz Westeuropa und in der Tschechoslowakei dieses Stück. 1965 produzierte der WDR zusammen mit SWF und BR eine Hörspielfassung des „Bürgermeisters“. Der SDR produzierte noch im Jahre 1965 eine Fernsehspiel-Fassung.
Am 2. Juli traf sich der Freundeskreis Gert Hofmann in der Limbacher Gaststätte „Stadt Wien“, um an den 25. Todestag des Autors zu erinnern. Die Gaststätte befindet sich in 50 Meter Entfernung vom ehemaligen Standort des Hofmannschen Geburtshauses, das vor Jahren abgerissen wurde, obwohl es auf der Landesdenkmalliste stand. Gert Hofmann besuchte die Gaststätte „Stadt Wien“ letztmalig am 24. Juli 1990, beim einzigen Besuch seiner Geburtsstadt, seit seinem Weggang. Die Gaststätte besitzt nach Wiener Vorbild noch die Original-Einrichtung von 1929. Es ist mittlerweile der einzige authentische Erinnerungsort an die Jugend Gert Hofmanns in Limbach.
Mitglieder des Freundeskreises führten an diesem Abend das Hörspiel „Autorengespräch“ auf. Dieses Hörspiel erfuhr seine Ursendung 1970 durch den WDR. Nach dem Hörspiel erinnerte Jochen Richter in kurzen Impressionen an den letzten Stummfilm-Pianisten im Limbacher Kino „Deutsches Haus“, in der Helenenstraße, der in Gert Hofmanns Roman „Der Kinoerzähler“ vorkam. Mitglieder und Gäste des Freundeskreises Gert Hofmann fanden sich abschließend noch einmal zum traditionellen Erinnerungsfoto in der Gaststätte „Stadt Wien“ zusammen (Foto unten). Es war ein Ereignis zu dem Sigfrid Hoyer eine kleine Ausstellung der Bücher Gert Hofmanns vorbereitet hatte.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 16. August 2018 -
Das Rußdorfer Sonnenbad
Das Rußdorfer Sonnenbad
Friedemann Maisch
Das alte Schwimmbad bestand nicht nur hauptsächlich aus einem Betonbecken. Seit 1982 arbeitete dort eine Filteranlage, die einzige im weiten Umkreis. Die Badegäste konnten sich auch bei sommerlichem Hochbetrieb im fast kristallklarem Wasser tummeln. Das war zu DDR-Zeiten in Schwimmbädern sehr selten anzutreffen und für Limbach-Oberfrohna fast eine Sensation. Die Filteranlage wurde von tatkräftigen Rußdorfer Bürgern innerhalb von zwei Jahren in nebenberuflicher Tätigkeit projektiert, errichtet und im Sommer 1982 in Betrieb gesetzt. Mannigfaltige Schwierigkeiten gab es bei der Beschaffung der Maschinentechnik zu überwinden, denn es herrschte die DDR-Mangelwirtschaft. Die Elektroanlage errichtete eine Handwerksfirma aus der Stadt. Für die Errichtung gab es weder Dringlichkeiten noch Bilanzen, das A und O der DDR-Planwirtschaft. In der Stadtverwaltung waren einige Mitarbeiter mit Weitsicht, die an das Gelingen des Projektes glaubten und die Finanzierung ermöglichten. Die Gesamtkosten für den Einbau der Filteranlage lagen deutlich unter 150.000 Mark. Es gelang sogar, dass der Energieversorger für das Bad extra eine Trafostation errichtete, das war zur DDR-Zeit fast einem Wunder gleichzusetzen. Die Maschinentechnik der Anlage wurde notgedrungen in Freibauweise angeordnet und arbeitete bis 2015 nahezu störungsfrei. Wenn auch das Betonbecken viele Flicken aufwies, in der DDR-Zeit galt das Sonnenbad als Musterbad, ist es doch landschaftlich sehr schön gelegen, die Badegäste konnten sich in klarem Wasser tummeln, das Umfeld war immer ordentlich gepflegt. Für die Jugend wurde ein Ballspielplatz geschaffen. Große Verdienste um das alte Rußdorfer Sonnenbad hat der ehemalige Schwimmmeister Klaus Mahn erworben, der das Schwimmbad über drei Jahrzehnte betreute.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 21. Juni 2018 -
Wüstungen um Wolkenburg-Kaufungen Die „Motte“ Zinnberg
Wüstungen um Wolkenburg-Kaufungen
Die „Motte“ Zinnberg
Rolf Kirchner
Auf halbem Wege zwischen dem Wolkenburger Hauboldfelsen und der Burgruine Zinnberg liegt etwa 200 Meter von der Bahnbrücke der Muldental-Eisenbahn entfernt eine weitere Wüstung. Oberhalb des rechten Muldenhanges liegen am Waldrand die bisher nicht erforschten Reste einer kleinen Wallanlage. Über diese Anlage existieren weder urkundliche Nachweise noch irgendwelche Abbildungen. Es könnte sich um eine sogenannte „Motte“ handeln, eine kleine mittelalterliche Anlage, die aus einem Wachtturm mit einem umlaufenden Wallgraben bestand. Die gesamte Anlage hatte sicherlich kaum mehr als einen Durchmesser von etwa 15 bis 20 Metern. Aus oberflächlich gefundenen Keramikscherben lässt sich bisher nur eine Existenz im 13./14. Jahrhundert ableiten. Wann sie errichtet wurde, wie lange sie existierte und welchem Zweck sie diente, kann nur vermutet werden. Tatsache ist, dass längs der Zwickauer Mulde eine Burgenachse von Glauchau bis Rochlitz existierte. Der Überlieferung nach soll sich etwa einen Kilometer flussabwärts der Burg Wolkenburg eine sorbische Ansiedlung befunden haben, eine „Sorbenschanze“. Denkbar wäre es, dass man in gewissen Abständen Kontrollbauwerke errichtete, um den Flusslauf zu überwachen. Weitere Beobachtungspunkte könnten die „Ruine“ am Hauboldfelsen sowie etwa 700 Meter unterhalb der Zinnburg ein über dem rechten Muldenhang befindliches Bauwerk sein. Der Rochlitzer Heimatforscher C. Pfau beschrieb diese Anlage am „Ziegenberg“ im Jahre 1909. Die Reste dieser Anlage wurden schon vor längerer Zeit eingeebnet. Aufschluss geben könnten in all diesen Fällen nur archäologische Grabungen.
Rolf Kirchner
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 24. Mai 2018 -
Die Rußdorfer Industrie
In den neunziger Jahren veröffentlichte der Rußdorfer Hans Lange (1922-2008) zwei Hefte unter den Titeln: „Ein Rußdorfer Heimatbild“ und „Rußdorfer Allerlei“. Der folgende Auszug ist den Heften entnommen.
Die Rußdorfer Industrie
Hans Lange
Rußdorf war sowohl von der Landwirtschaft als auch von der Industrie her ein recht interessantes Dorf. Das ursprünglich reine Bauerndorf hat sich Mitte des 18. Jahrhunderts auch industriell so gemausert, das sich um die letzte Jahrhundertwende herum Industrie und Landwirtschaft fast die Waage hielten. Neben rund 50 Bauernwirtschaften gab es in Rußdorf ca. 30 kleinere, mittlere und größere Industriebetriebe. Darunter waren 4 größere Strumpffabriken, 4 kleinere Handschuhfabriken, 12 Wirkstoff-Fabriken und eine ganze Anzahl von Maschinenfabriken und Schlossereien. Die Rußdorfer Strumpfwirkerinnung wurde bereits 1745 gegründet. Sie hatte u.a. das Recht, Limbacher Strumpfwirkern das Meisterrecht zu erteilen, denn dort wurde diese Innung erst 40 Jahre später ins Leben gerufen. Schon damals wurden in Rußdorf außer Strümpfen, Handschuhen und Mützen auch Beinkleider sowie Kleidungsstücke und viele feine Arbeiten hergestellt und vertrieben. Mit Schiebböcken wurden die Waren nach den Märkten in Glauchau, Zwickau und Altenburg transportiert und dort verkauft. Die Händler besaßen Altenburger Reisepässe, in denen die Händler genauestens beschrieben wurden, weil es ja noch keine Fotos gab. Da ist zunächst von der Färberei Wünschmann zu berichten, die Anfang der zwanziger Jahre in Konkurs ging. Sie war seinerzeit die größte Färberei im Umkreis. Zu ihr gehörte auch der über 80m hohe Schornstein, er nie oder kaum geraucht haben soll, weil seine Fertigstellung fast mit der Pleite zusammenfiel. Wünschmanns waren sehr wohlhabend. Ein Einblick in die Konkursakten, den ich in meiner Lehrzeit beim Rechtsanwalt Schurich hatte, bestätigte das voll und ganz. Über die Ursache des Kaputtgehens möchte ich lieber keine Angaben machen. Vielleicht hatte das auch was mit Inflation zu tun. Ganz ähnlich ist es wohl der Firma Max Pressler&Co. ergangen, die Anfang dieses Jahrhunderts von Chemnitz nach Rußdorf kam. Sie stellte vorwiegend Öl-, Kerzen-, Karbid- und Petroleumlampen für Fahrräder, Kutschen und für den Hausgebrauch her. Schon vor dem 1. Weltkrieg würden hier mehr als 200 Arbeiter beschäftigt. Aus Messingblechen wurd3en Partien von mehreren tausend Stück gestanzt, auf der Ziehpresse gezogen und im Glühofen ausgeglüht. Dann bearbeiteten Metalldrücker die gestanzten Teile, die dann abgestochen, poliert und geändert wurden. In die Grundform wurden in der Klempnerei Brennerdüsen, Sitzmuttern usw. eingelötet. Schließlich wurde alles poliert und vernickelt. Nachdem jede Lampe durchprobiert war, kam sie schließlich zum Versand. Die Firma hatte ihren Abnehmer im gesamten Westeuropa. Durch den 1. Weltkrieg und die Nachkriegsjahre wurde die Firma langsam kaputtgemacht. Nur ein winziger Rest der Firma vegetierte noch einige Jahre langsam dahin, man kam nicht mehr auf die Beine. Man hatte auch vergessen, auf die inzwischen aktuelle elektrische Beleuchtung umzustellen. Der größte Brötchengeber in den Jahren danach war ohne allen Zweifel die Strumpffabrik Welker & Söhne, die in den dreißiger Jahren mehr als 500 Arbeiter beschäftigte. An der Entwicklung hatte der Inhaber der Firma, William Welker, wohl den größten Anteil. Welker & Söhne ging aus der Firma S.F. Engelmann hervor, die 1848 gegründet wurde. William Welker führte sie bis zu seinem Tode. Er war Fachmann durch und durch, hatte sich ein gutes Kollektiv von Facharbeitern geschaffen und ständig Neuerungen im Maschinenpark vorgenommen. Die Beziehungen zu seiner Belegschaft waren stets recht gut. Ich selbst lernte seine Hilfsbereitschaft und sein Entgegenkommen kennen. Die Waren dieser großen Strumpffabrik waren im In- wie auch im Ausland vor allem wegen ihrer ausgezeichneten Qualität bekannt. Ähnliches kann auch von den kleineren Firmen Alban Curt Müller und Kadelbach gesagt werden. Sicherlich war es ein großer Fehler, diese bekannten Firmen in der DDR in ihrer Produktion umzustellen. In einer ganzen Anzahl von mittleren und Kleinstbetrieben wurden ca. 300 Arbeiter beschäftigt. Hier wurden Handschuhe, Wirkstoffe und entsprechendes Zubehör gefertigt. Auch Appreturen und Färbereien gab es in Rußdorf. In der Metallwarenindustrie gab es wohl 6 Betriebe, die, wie beispielsweise die Emil Sonntag KG und die Firma August Niekamp mit eigenen Patenten arbeiteten, ihre Waren ebenfalls exportierten und so für Arbeit und Brot der Rußdorfer und für viele aus dem „Tal der Liebe“ (Langenberg, Falken, Langenchursdorf) sorgten. Industrie, Gewerbe, Handwerk und Bauernschaft waren in der Lage, allen Rußdorfern Arbeit und Brot zu geben. Diese gute Tradition wurde zunächst auch nach dem 2. Weltkrieg fortgesetzt, beispielsweise auch durch die Firmen Fritz Esche und den Wägemaschinenbau. Hier wurde wiederum mit eigenen Patenten gearbeitet. Herr Gräbner wurde beispielsweise sogar als verdienter Erfinder ausgezeichnet und geehrt. Man lasse sich das alles einmal auf der Zunge zergehen. Rußdorf hatte ca. 4000 Einwohner mit 50 Bauernhöfen, etwa 200 Handwerkern und Gewerbetreibenden und fast 30 Industriebetrieben. Es gab Künstler, Akademiker, Erfinder und vieles andere in Rußdorf. Und da sollen wir Rußdorfer nicht stolz sein? Kein Wunder, das uns die Sachsen und die Oberfrohnaer und später natürlich auch die Limbacher haben wollten.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 15. März 2018 -
Kriminalfälle in alter Zeit (1595-1881)
Kriminalfälle in alter Zeit (1595-1881)
Dr. Hermann Schnurrbusch
1595, den 4. Juli wird der hiesige Bauer Märten Poppe wegen Giftmischerei verbrannt. 1645 wird Christiane Schubert aus Kaufungen, welche in Mittelfrohna von ihrem Dienstherren Görge Friede, einem Ehemanne, beschwängert worden, mit Staupenschlag und ewiger Landesverweisung und Friede, weil ihm seine Frau verziehen und der Pfarrer ihm ein gutes Attest ausgestellt, nicht zur Todesstrafe, sondern zu ewiger Landesverweisung, wohin ihm sein Weib zu folgen hatte, oder aber wenn es die Gerichtsherrin Christiane von Schönberg genehmigen wolle mit 100 Gülden bestraft. Laut Urteil des Schöppenstuhles zu Leipzig von 1645 und 1646. Auf Friedes und seiner Frau Gesuch gestattete die Gerichtsherrin das Letztere. 1666 hat Susanna Schneider, des Schmidts Eheweib, in Mittelfrohna vor Gericht gestanden, dass sie ihren Brautkranz zur Leiche ihrer Pate in den Sarg getan und dass sie neun Tage darnach den Bräutigamskranz ihres Mannes mit Taranten (Spinnen?), Dill et cetera vermengt durch ihre Schwester in Michael Müllers Kindes Sarg, das an einer Nuß erstickt war, legen lassen, was ihr ihre Mutter Margarathe Rother anbefohlen habe. Beide hatten laut Urteil des Schöppenstuhles zu Leipzig die aufgelaufenen Kosten zu bezahlen und den Reinigungseid dahin zu leisten, dass sie dabei weder Hexerei noch Zauberei betrieben. 1679 kommen Hans Thieme, sein Eheweib Marie und dessen Hausgenossen Anna Arnold allerseits von Köthensdorf wegen einer ruchbaren Menschen- und Viehverderbung und eines schändlichen Feuersegenbriefes, item einer freventlichen Garten- und Felderaushütung, sowie auch wegen Zank und Schmähung beim Limbacher Patrimonialgerichte in Untersuchung. Sie werden vom Schöppenstuhle in Leipzig zwar von der Hexerei freigesprochen, aber in die Kosten verurteilt. Dieses sind jedenfalls die letzten Hexenprozesse in hiesiger Gegend. 1736 wird der abgesetzte Schulmeister Johann Fischer in Limbach angeklagt wegen des Ehebruches mit der gleichfalls angeklagten Christine Martini, des Schönbergschen Jägers Eheweib und wegen der Vergiftung deren Mannes. Im Limbacher Kirchenregister 1734 steht: „Johann Gottlieb Martini, Hochadliger Schönbergisch gewesener Jäger, seelig verstorben den 1. Dezember, mit einer Leich-Predigt begraben folgenden 5., als am 2. Advent-Sonntage, aet. (seines Alters) 45 Jahr 4 Monat und 1 Tag. Dieser Jäger wurde seciret (seziert) und Gift bei ihm gefunden.“ Verurteilt wurden beide zur ewigen Landesverweisung, die aber in die Strafe des Festungsbaues für den Schulmeister und des Zuchtshauses für die Jägerin umgewandelt wurde. Die peinliche Untersuchung, die Sektion der Leiche, Gerichtsgebühren, Tortur (Folter) und die Unterbringung der Jägerin im Zuchthaus hatten einen Kostenaufwand von 273 Talern erfordert. 1807 wird Eva Rosine, verwitwete Bonitz, Hebamme in Köthensdorf, mittelst Schwertes enthauptet und ihr Körper auf das Rad des Galgens, welcher zwischen Limbach und Oberfrohna stand, geflochten. Am 7. August wird ihr Schwiegersohn, Gottlob Schellenberger, auf dem Markt zu Chemnitz mit dem Schwert hingerichtet. Er hatte den zehnjährigen Sohn der Bonitzin mit Arsenik vergiftet, die Mutter hatte dazu das Gift besorgt, um das väterliche Erbteil des Kindes, welches in einigen hundert Talern bestand, in die Hände zu bekommen. 1881 Am 3. September überfällt der 25-jährige Limbacher Flei-schergeselle Carl Theodor Türpe in Mittelfrohna die siebenjährige Lydia Clara Voigt, missbraucht und ermordet sie. Das Königliche Schwurgericht Chemnitz verurteilt ihn im Dezember 1881 zum Tode und wegen anderer Verbrechen zu 15 Jahren Zuchthaus. Ob das Todesurteil vollstreckt wurde, ist unbekannt.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 15. Februar 2018 -
Die legendäre Kreuzeiche
Die legendäre Kreuzeiche
Friedemann Maisch
Über die legendäre Kreuzeiche gibt es nur vage Berichte. Gesichert ist, dass die uralte Eiche an der Wegekreuzung des Burgstädter Weges – heute Burgstädter Straße - zum Weg entlang des Pfarr-baches und unweit des Neuteiches stand. Zuerst wurde laut dem Chronist Paul Seydel die Kreuzeiche in einer Beschwerde im Jahre 1689 vom Rittergutsbesitzers von Schönberg an das Amt Penig zu Holzdiebstählen benannt. Es heißt dort unter anderem „in Meinem holze über der ‚Kreuz-Ege‘ an schwartzen Wiesen ...“. Die Schwarzen Wiesen befanden sich längs des Pfarrbaches. Auf der ältesten Generalstabskarte Sachsens ist der Baum östlich des Burgstädter Weges eingetragen. Der damalige Burgstädter Weg ist mit dem heutigen Straßenverlauf nicht identisch. Wenn man sich die Verlängerung des heutigen Kreuzeichenweges vorstellt, das war einstmals der alte Burgstädter Weg. Mitte des 19. Jahrhunderts war vom legendären Baum keine Spur mehr vorhanden, so berichtete das der Chronist Ernst Seidel. Wenn man bedenkt, dass Eichen über 1.000 Jahre alt werden können, zum Beispiel sind das die heutigen Eichen von Ivenack in Mecklenburg, muss diese Eiche sehr alt gewesen sein, ehe sie zerfiel. Der damalige Wald, wo sich die Eiche befand, war ausgedehnt, heute ist er bis auf den Hohen Hain verschwunden; er erstreckte sich damals vom Neuteich bis zum Elzing. Dort war auch das Reich des „Wilden Mannes“, des hünenhaften Waldhüters Johan Samuel Römer (1784-1866), in dessen Vollbart sich eine zahme Haselmaus aufgehalten hätte. Vom Waldhüter Römer und seiner Frau ist ein Foto aus den Anfängen der Fotografie erhalten ge-blieben, welches vom Nachfahre und Landwirt Reiner Fiedler aus Rußdorf sorgsam gehütet wird. Überliefert ist vom Waldhüter Römer folgende Geschichte: „vom Vieh hüten weg pressten kursächsische Soldaten-Werber den erst 13- jährigen Samuel Römer zum Militärdienst. Er musste dann als sächsischer Soldat 1812 den Feldzug von Napoleon nach Russland mitmachen und konnte auf dem chaotischen Rückzug bei günstiger Gelegenheit desertieren. Wie immer in der Geschichte waren die Sachsen auf der Seite der Kriegsverlierer. Er durschwamm unter anderem bei der Flucht einen breiten Fluss, wahrscheinlich die Weichsel, die Kugeln der Verfolger verfehlten ihn nur knapp. Er trat dann bei den Mecklenburger Truppen in den Militärdienst und wurde schließ-lich wegen seiner hünenhaften Gestalt Bursche beim Grafen von Schwerin. Nach dem Dienst in Schwerin kehrte er heim zu seinen Eltern. Auf dem Heimweg, das waren täglich zirka 35 Kilometer Fußmarsch, bekam er ohne Probleme bei Bauern und Bürgern Un-terkunft und Verpflegung. Man war begierig zu erfahren, was es für Neuigkeiten in der Welt gab und was für Abenteuer Samuel Römer erlebt hatte. Der damalige Limbacher Rittergutspächter, der Graf von Wallwitz, suchte zirka 1825 einen Waldhüter, denn die immer zahlreicher werdenden Limbacher Bürger plünderten die Wälder, um ihre Stuben zu beheizen. Wilderer bedienten sich ebenfalls am gräflichen Eigentum. Aus dem Wald durften Holzsammler damals nur dürres Geäst mitnehmen, was eine Person auf dem Rücken zu tragen vermochte. So waren in feudaler Zeit die Regeln. Kohlen und Briketts standen damals nicht zur Verfügung, denn es gab noch keine Eisenbahn. So wurde Samuel Römer vom Grafen im Oesterholz beziehungsweise Elzing als Waldhüter eingesetzt. Er konnte sich in der Nähe der Kreuzeiche ein Blockhaus mit Wassergraben und Zugbrücke bauen, um sich vor rabiaten Holzsammlern und deren Racheakten zu erwehren. Sein Mut und die stetige Präsens im Wald, seine Körperkräfte und der Ruf als „Wilder Mann“ haben wohl damals die Holz- und Wilddiebe wirksam abgeschreckt. Seit der Kaiserzeit gab es am Neuteich ein Gasthaus mit Tanzboden mit dem Namen „Kreuzeiche“. Im Zweiten Weltkrieg wurden dort von der deutschen Wehrmacht laut Zeitzeugen russische Kriegs-gefangene unter katastrophalen Bedingungen untergebracht. Das Gasthaus ist längst abgerissen; dort ist heute ein Parkplatz. Der Tanzsaal, an der Damaschkestraße gelegen, wurde Garage und von der Kreuzeiche sind nur noch der Name und die Legende übrig geblieben.
-veröffentlicht im Stadtspiegel am 15. Februar 2018 -
Das "Bräustüb’l" an der Peniger Straße
Das "Bräustüb’l" an der Peniger Straße
Dr. H. Schnurrbusch - aus dem Heft „Vergangenes“ © 2015
Das kleine Fachwerkhäuschen stand an der Peniger Straße 3 und soll um 1785 vom Rittergut Limbach - also unter Helena Dorothea von Schönberg - erbaut worden sein. Ein genauer Nachweis für diese Angabe in einer Anzeige von 1952 findet sich nicht, aber Aussehen und Baustil des Gebäudes sprechen dafür. Im Plan der Rittergutsliegenschaften von 1785, den der Geometer Krause aus Glauchau im Auftrage der Gutsherrin angefertigt hat, ist das Gebäude noch nicht eingezeichnet.
Belegt ist, dass ein späterer Rittergutsbesitzer, nämlich Freiherr Otto von Welck, den „Kellerberg“ zur Bebauung erschließen ließ. Der Name „Kellerberg“ kommt von den in den Felsen eingehauenen Kellerräumen und Gängen, die auf Georg I. von Schönberg zurückgehen sollen, der sie nach Meinung von Paul Fritzsching um 1571 im Berg anlegen ließ. Für die Anhöhe, auf der heute der Ludwigsplatz liegt, war eine Zeitlang wegen des Hopfenanbaus auch der Name „Hopfenberg“ gebräuchlich, im Volksmund „Hoppberg“.
Am Fuße des Kellerbergs auf der Kellerwiese ließ Welck 1855 eine „Bairische Brauerei“ errichten, die später nach einem anderen Besitzer „Eyssens Dampfbrauerei“ hieß, noch später im Gegensatz zur „Stadtbrauerei“ am Markt 5 als „Bürgerliches Brauhaus“ firmierte. Die Brauerei versorgte die Limbacher mit Bier, das auf bayerische Weise gebraut war und auch mit Bier nach Pilsener Machart. In der Brauerei konnte der Hopfen vom Kellerberg gleich ohne große Transportwege verwendet werden und die Keller als Bierlager.
Das Häuschen Peniger Straße 3 wurde so zur ersten Ausschankstätte der nebenan gelegenen Brauerei und erhielt wegen des Biers den Namen „Bavaria“. Als später eine zweite Gaststätte gleichen Namens an der Anna-Esche-Straße 3 eingerichtet wurde, bürgerte sich der Name „Alte Bavaria“ als Unterscheidung zu der „Neuen Bavaria“ ein. Nachdem die Brauerei eingegangen war, stand auch die „Bavaria“ einige Zeit leer.
Der Gastwirt Theodor Trölltsch, ein früherer Braumeister, eröffnete die Gaststätte am 12. Dezember 1928 wieder und gab ihr den neuen Namen „Bräustüb’l“. Unter dem Haus lag der Eingang zu den Kellerräumen, die sich hinter dem heutigen Apollokino im Berg befinden. Der rührige Gastwirt richtete in diesen Kellern einen Schießstand ein, der am 9. Februar 1931 eingeweiht wurde und den „nationalen Vereinen“ der Stadt zur Verfügung stand. Von 1939 an dienten die Keller dann als öffentlicher Luftschutzraum.
Trölltsch schenkte im „Bräustübl“ bis 1946 Bier aus, dann ruhte der Betrieb und wurde erst am 31. Januar 1952 wieder aufgenommen. Nach einigen Jahren stellte man die Bewirtschaftung ein. Die Gastzimmer dienten dann noch der Steuerberaterin K. Lindner als Gewerberäume. Leider verfiel das Häuschen mit dem romantischen Aussehen immer mehr, so dass es nicht mehr erhalten werden konnte. Die Abrissverfügung des Bauamtes datiert vom 30. November 1992, der Abbruch war am 26. August 1994 beendet. Schade drum.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 1. Februar 2018 -
Willy Böhme (1875 -1932) – 24 Jahre Bürgermeister von Oberfrohna
Willy Böhme (1875 -1932) – 24 Jahre Bürgermeister von Oberfrohna
Aus Dr. H. Schnurrbusch: Personen und Persönlichkeiten © 2006
Willy Böhme war von 1908 bis 1932 erst Gemeindevorstand, dann Bürgermeister in Oberfrohna. Er wurde am 28. August 1875 in Sebnitz geboren worden und hatte von Jugend an den Wunsch, Gemeindebeamter zu werden. Seine Laufbahn begann beim Stadtrat Sebnitz, dann wurde er Beamter in den Städten Freiberg, Annaberg und Ronneburg. 1901 wählte ihn der Ort Sehma zum Vorstand und 1908 die Gemeinde Oberfrohna. Das Dorf Oberfrohna hatte damals etwa 5.000 Einwohner. Sicher hat der junge Gemeindevorstand - er konnte sich ab 1924 Bürgermeister nennen - die gesellschaftlichen und kommunalpolitischen Umstände bald richtig erkannt und die Interessen des Ortes mit denen der Bürger, der Wirtschaft und der Politik erfolgreich verbunden, denn unter allen benachbarten Dörfern konnte sich als einziges nur Oberfrohna im 20. Jahrhundert zur Stadt entwickeln. Die Gemeinde Oberfrohna hatte 1908 schon eine gewaltige Wandlung vom kleinen, landwirtschaftlich geprägten Dorf mit Kleinhandwerk und Strumpfwirkerei zum Industrieort mit bedeutender Fabrikation von Stoffhandschuhen durchlaufen. Schon 1889 gab es in Oberfrohna 35 Handschuhfabriken und -großhandlungen. 6 Appreturen, 4 Färbereien und 4 Kartonagenfabriken. Über 75 Prozent der Textilprodukte wurde exportiert, mehr als ein Drittel in die USA. Bedeutende Firmen wie Heinrich Rätzer, Hermann Grobe oder Herrmann Dittrich schafften Arbeitsplätze und Verdienst. 1913 wurden in Oberfrohna mit 5.816 Einwohnern 2.824 Arbeitsplätze gezählt, an denen 1.743 Männer und 1.081 Frauen beschäftigt waren. Es herrschte Vollbeschäftigung, und viele kamen aus den umliegenden Dörfern nach Oberfrohna auf Arbeit. Mit dem Bestreben, sich von Limbach unabhängiger zu machen, durchlief das Dorf Oberfrohna den Prozess der Verstädterung und Industrialisierung vom Industriedorf zur Kleinstadt. Nach 1836 schuf sich die Gemeinde eine eigene Schule, eine Kirche, einen Friedhof. Vorher mussten die Oberfrohnaer diese Einrichtungen in Limbach nutzen. Es entstanden das Postamt, ein Gaswerk und die zentrale Wasserversorgung. Oberfrohna bekam eine Apotheke, ein Elektrizitätswerk und 1904 sogar ein Schwimmbad an der Neuen Straße. Die Bevölkerungszahlen hatten sich sprunghaft entwickelt. Im Jahre 1834 gab es in Oberfrohna 82 Häuser mit 642 Bewohnern, die Einwohnerzahl stieg 1882 auf 2.398, 1910 auf 5.269. Der Ort wuchs, gedieh und wurde im Vergleich mit Mittel- und Niederfrohna in der Presse als „die blühendste der drei Frohnen“ bezeichnet.
In dieser Zeit des Aufschwunges und Wirtschaftswachstums nahm Willy Böhme seine Tätigkeit auf und half dem Ort zu weiterem Fortschritt. Er bemühte sich zuerst um die Stärkung der kommunalen Interessen. Elektrizitätswerk, Gas- und Wasserwerk wurden errichtet oder erweitert, so dass Oberfrohna seine Nachbargemeinden von Rußdorf, Bräunsdorf, Niederfrohna bis Kaufungen mit versorgen konnte. Die Eisenbahnanbindung mit der Strecke Limbach-Oberfrohna im Jahre 1913 stellte einen besonderen Erfolg dar, der die langen und schwierigen Bemühungen Böhmes und anderer belohnte. Leider gelang es nicht, diese Strecke in Richtung Leipzig weiter zu führen. Alle diese Bemühungen machte der I. Weltkrieg zunichte. Danach gewann die Straße mehr an Bedeutung vor der Schiene. Sein Gemeinwesen brachte Böhme voran durch den Bau der Feuerwache 1927, die Einrichtung einer Volksküche (1930) oder der Erholungsstätte für Kinder im Gemeindewald (1923). Oberfrohna vergrößerte seine Schule durch Erweiterungsbauten 1909 und 1927, erhielt ein Rathaus (1924) an der Limbacher Straße (jetzt Straße des Friedens 100). Das "Jahnhaus" als Vereins- und Sportzentrum wurde 1929 eingeweiht. Diese Vorhaben konnten dem geachteten Bürgermeister nur mit Hilfe der örtlichen Industrie und einer solidarischen Bürgergemeinschaft gelingen. Ein anderes gesellschaftliches Zentrum des Ortes war das Hotel "Rautenkranz". Dort trafen sich die Vereine, es fanden Bälle und Feierlichkeiten statt, auch die Ankunft der ersten Eisenbahn wurde dort 1913 gefeiert.
Die Oberfrohnaer identifizierten sich mit ihrer Gemeinde und waren bereit, zum Gemeinwohl in ihrem Ort beizutragen. Sie waren stolz auf die Entwicklung ihres Ortes, der in vieler Hinsicht ein eigenes gesellschaftliches, politisches, besonders auch kulturelles Klima entfaltete und sich so von Limbach abhob. Oberfrohna wurde zu einer der bedeutendsten Landgemeinden in Sachsen. 1921 führte der Ort bei 600 Millionen Mark Umsatz allein 3 Millionen Umsatzsteuer an den Fiskus ab. Die Einwohner waren mit ihrem Bürgermeister zufrieden, sie wählten ihn wieder, schließlich auf Lebenszeit. Eine Mehrheit im Gemeinderat aus der Bürgerlichen Fraktion und SPD setzte sich gegen die KPD-Meinung durch, die lieber einen Kommunisten als Bürgermeister gehabt hätte. In Oberfrohna kam eher zwischen den Bürgerlichen und Sozialdemokraten Einvernehmen in kommunalen Fragen zustande, als zwischen SPD und KPD.
Böhme linderte die Wohnungsnot, indem er persönlich die Wohnungsgenossenschaften „Gartenstadt“ und „Bau- und Sparverein“ gründete, die Wohnhäuser an der Nord-, Hain- und Mittelstraße erbauten. Außerdem ließ er kommunale Wohnungsbauten u.a. an der Feldstraße (heute Industriestraße) errichten und den Frohnbach teilweise überwölben. Rege Bautätigkeit zeigte das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum an. Neue Häuser der Baugenossenschaft „Eigenheim“ entstanden an der Karl-Marx-Straße (später Horst-Wessel-Straße, Am Jahnhaus) und am Siedlerweg (heute Siedlerstraße). Nach guten Zeiten forderte der I. Weltkrieg 216 Todesopfer in Oberfrohna. Danach kamen Kapp-Putsch und 1923 die Besetzung Oberfrohnas durch die Schwarze Reichswehr, die im Namen der „Reichsexekution“ Gewalt und Terror verbreitete. Die Inflation brachte Hunger und Elend, es folgten die politisch schwierigen Zeiten der Weimarer Republik. Über 24 Jahre war der Bürgermeister Böhme auch unter problematischen Bedingungen erfolgreich tätig, vermittelte unter eskalierenden Parteikämpfen und konnte den Gemeinderat mit KPD, SPD und Bürgerlicher Fraktion zu konstruktiven Lösungen bewegen.
Nach 1928 verschlechterte sich die Gesundheit des Bürgermeisters durch eine Zuckerkrankheit. Er wohnte zu der Zeit mit seiner Frau Frida und vier Kindern im Haus Bahnhofstraße 6. Sein behandelnder Arzt Dr. med. Wilhelm Hintze (Hauptstraße) konnte den Gesundheitszustand seines Patienten aber wohl einigermaßen stabilisieren.
An den Folgen eines Unfalles ist Willy Böhme am 27. Februar 1932 verstorben. Die Beerdigung fand unter sehr großer Teilnahme der Bevölkerung statt, die den Tod ihres Bürgermeisters als bedeutenden Verlust empfunden hat. Im Nachruf stand, er habe es verstanden, auch in politisch schwierigen Zeiten auf seinem schweren Posten zum Wohle der Gemeinde über den Parteien zu stehen. „Sein besonnenes und ruhiges Wesen war immer Mittler, wenn es galt Gegensätze zu überbrücken und dadurch das Allgemeinwohl zu wahren.“ Sein Grab war noch bis 1998 auf dem Oberfrohnaer Friedhof zu sehen. Die Erhaltung seines Grabsteines war mit dem Kirchenvorstand leider nicht zu verwirklichen. Die integre und kompetente Persönlichkeit von Willy Böhme hat wesentlich zur Entwicklung Oberfrohnas beigetragen. Leider hat Böhme nicht mehr erlebt, dass Oberfrohna 1935 vom Dorf zur Stadt wurde. Er hat es verdient, den Oberfrohnaern in Erinnerung zu bleiben. Im Jahre 2004 wurde die frühere Bahnhofstraße nach ihm benannt.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 3. August 2017 -
Die dicke Rußdorfer Fichte
Die dicke Rußdorfer Fichte
Friedemann Maisch
Die dicke Rußdorfer Fichte befand sich bis 1919 neben weiteren starken Fichten im Rußdorfer Holz, einem ausgedehnten Bauernwald, der sich von Meinsdorf bis zum Großen Teich und bis zum Gelände der Firma Riedel Textil (früher Ziegelei Gottschalk) an der Rußdorfer Talstraße erstreckte. Die legendäre „Dicke Fichte“ wies einen Stammumfang von 2,40 Meter auf, eine weitere Fichte von 2,19 Meter. Wie der Chronist Karl Fritsching berichtete, standen die 200-jährigen Fichten am Waldrand nahe den Schimmelschen Teichen. Die Feuerungsnot in den Nachkriegsjahren des 1. Weltkrieges bewirkte ein Abholzen nicht nur des Rußdorfer Holzes, sondern auch des Stadtparkes. Wie mein Schwiegervater (1909-1987) als Augenzeuge berichtete, riefen die Bauern die Polizei zu Hilfe. Bald waren die Gendarmen an Ort und Stelle. Daraufhin schossen Kriegsheimkehrer mit illegalen Waffen in die Luft, denn zu Hause warteten frierende Frauen und Kinder. Das hatte man nicht gedacht, als die Soldaten 1914 am Limbacher Bahnhof unter großem Jubel, mit Fahnen und Girlanden sowie grenzenloser Begeisterung und mit Marschmusik verabschiedet wurden. Nach den Schüssen verschwanden die Gendarmen und die Sägen und Äxte verrichteten im Rußdorfer Wald weiter ihr zerstörerisches Werk. Wie wir wissen, waren auch in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg in den umgrenzenden Wäldern, zum Beispiel im Hohen Hain, Rußdorfer Holz und im Gemeindewald, größere und ebenfalls zerstörerische Abholzungen zu verzeichnen. Über 100-jährige Bäume sind im Limbacher Land deshalb eine Seltenheit geworden.
Heute existiert in Sachsen eine Rekordfichte von zirka fünf Meter Umfang. Dieser Baumriese befindet sich am fast unzugänglichen Bach der Kirnitsch in der hinteren Sächsischen Schweiz.
Friedemann Maisch im Auftrag der Fördervereins Esche-Museum
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 3. August 2017 -
Hanne Treff – der „Verslmacherin“ zum 130. Geburtstag
Hanne Treff – der „Verslmacherin“ zum 130. Geburtstag
Dr. H. Schnurrbusch © 2017
Im vorigen Jahrhundert gab es in Limbach/Sachsen eine Heimatdichterin, die heute fast vergessen ist – Hanne Treff, geb. 14.5.1887 in Annaberg, gestorben 11.5.1957 in Limbach.
Das Limbacher Tageblatt vom 12.11.1930 schildert eine Veranstaltung im großen Saal des Hotels „Hirsch“, für die Hanne Treff den Spielplan geschrieben und Regie geführt hatte. Es war ein Heimatabend des Ev. Frauenvereins im Sinne seiner Aufgabenstellung zu wirken für die Heimat, für die Frauen und für die Unterstützung Bedürftiger. Das Programm war gestaltet mit Musik, Gesang und Darstellung eines Bühnenspiels von Hanne Treff mit dem Titel „Zeitgedanken“, in dem u.a. Quersackindianer als Sinnbilder früherer Produzenten mit dem „Lied der Alten“ der Heimatdichterin auftraten („Wir sind die Quersackindianer, / schaffen mit Fleiß immerzu. / Wir nähen, wir zwickeln, wir formen / die Herren- und Damenhandschuh’. usw.“ über neun Strophen). „Schreibmaschinenmädchen“ symbolisierten die gegenwärtige Arbeitswelt. Die Laiendarsteller kamen aus dem Dramatischen Verein der Stadt, Musik vom Städtischen Orchester und der Gesang von allen Gästen des ausverkauften Hauses.
Damit ist das Wirken der „Verslmacherin“ skizziert. Sie schrieb heitere und besinnliche Lieder, Gedichte und Bühnenstücke teilweise in erzgebirgischer Mundart für den Erzgebirgsverein, für öffentliche Aufführungen oder Feiern und Festlichkeiten, immer aus ihrer Motivation, mit der Liebe zur Heimat Freude zu bereiten. Damit ist auch das Interesse des Limbacher Publikums an der Heimatpflege und Heimatgeschichte beleuchtet. Der Erzgebirgsverein (1878 gegründet) hatte in Sachsen 170 Zweigvereine und vor 1945 mehr als 28.000 Mitglieder. Er war einer der ältesten und traditionsreichsten Heimat-, Gebirgs- und Wandervereine in Deutschland, seine monatliche Vereinsschrift hieß und heißt heute wieder „Glückauf!“ Der Verein wurde wie alle Vereine 1945 verboten. Er war 1937 vom nationalsozialistischen „Heimatwerk Sachsen“ des Gauleiters Mutschmann vereinnahmt worden war. Neu gegründet wurde er 1955 in Göttingen, 1989 in Pobershau.
Die Limbacher gründeten 1883 einen Zweigverein, der sich den Zielen des Dachverbandes wie das Anlegen von Wegemarkierungen, Aussichtstürmen und -punkten, Erhaltung der Natur- und Kunstdenkmäler, Ausbau von Verkehrsverbindungen und Jugendherbergen, Berggaststätten usw. verschrieb und daneben besonders die Umgebung der Heimatstadt verschönern wollte. Dazu gehörte 1886 der Bau des Maria-Josefa-Turms auf dem Totenstein gemeinsam mit dem Zweigverein Rabenstein, Anpflanzungen im Stadtpark, das Aufstellen zahlreicher Bänke, Wegetafeln, Wegweiser und der Bau einer Rodelbahn im Hohen Hain 1912, nicht zuletzt die Errichtung einer Anton-Günther-Stätte im Stadtpark 1938. Der Verein veranstaltete und unterstützte Ausflüge, Wanderungen und Schülerreisen, auch Hutzen- und Theaterabende. Gern und oft zu Gast war auch der Chemnitzer Lehrer Max Wenzel, neben Anton Günther der produktivste Dichter erzgebirgischer Mundart. Seine Tochter Lore war viele Jahre Praktische Ärztin in Röhrsdorf.
In diese Atmosphäre hinein wirkte Hanne Treff mit ihren vielen Bühnenstücken und Liedern in enger Gemeinschaft mit dem hiesigen Erzgebirgsverein. Zum Heimatfest anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Stadt Limbach 1933 schuf Hanne Treff des Festspiel „Vom Einst zum Jetzt“, das beim Publikum so großen Beifall fand, dass es nach der Premiere in der Parkschänke noch mehrmals aufgeführt werden musste. 1934 schrieb die Dichterin ihr erstes größeres Erzgebirgsspiel „Dr Waag ze Kraft un Schiehat“, 1935 folgte „Ben Weigelt-Schuster“. Großen Erfolg erzielte 1939 das Spiel „In der Sommerfrisch“. Das Bühnenspiel „Dicht ben Schlagboom“ konnte durch den Kriegsausbruch 1939 nicht mehr aufgeführt werden. Auch über Limbach hinaus konnte Hanne Treff ihre Lieder und Gedichte vortragen wie zum Tag der Erzgebirger 1935 in Berlin, zur Rundfunkausstellung in Berlin und an anderen Orten. 1938 ließ sie in einem Bühnenstück „Im Anna-Esche-Gässchen spukt’s“ Figuren aus der Limbacher Vergangenheit auftreten, ebenso in den Stücken „Das Glück im Quersack“ (1939) und „Geheimnis der Hofkatze“, hier ging es um Episoden aus der Limbacher Rittergutsgeschichte. 1940 erschien im Friedrich Hofmeister Verlag, Leipzig eine Broschüre mit 12 Liedern von Hanne Treff in erzgebirgischer Mundart mit dem Titel „Mei Liederstraißl“. Eine Liedpostkarte wurde in Limbach gedruckt mit dem Heimatlied „Mein Limbach“. Andere Lieder und Gedichte sind nicht veröffentlicht worden, so z.B. Soldatenlieder, die die Dichterin den verwundeten Soldaten in den Limbacher Lazaretten vortrug. 1945 wurde der Erzgebirgsverein verboten, für Hanne Treff fehlte jetzt die Möglichkeit zu Vorträgen oder Aufführungen, sie trat nun gern bei Betriebs- oder sonstigen Feiern auf und blieb den Limbachern in geschätzter und hoch gewürdigter Erinnerung. Der Kulturbund gratulierte ihr noch 1957 in seinem Monatsheft „Kultur und Heimat“ zum 70. Geburtstag, den sie aber nicht mehr erlebte. Sie starb vor 60 Jahren drei Tage vor ihrem Geburtstag ganz erblindet im Limbacher Krankenhaus.
Leider sind uns Treffsche Werke oder ein Bild von ihr nicht überkommen, vielleicht findet ein Leser noch etwas in privaten Beständen – das Stadtarchiv würde sich sehr freuen.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 25. Mai 2017 -
Vergessene Burgen und Rittersitze (2) Die Wasserburg des Kunz von Kaufungen
Vergessene Burgen und Rittersitze (2)
Die Wasserburg des Kunz von Kaufungen
Rolf Kirchner
In den Jahren ab 1165 etwa entstanden sowohl längs der Zwickauer Mulde als auch an der alten Peter und Paul-Straße Groitzsch-Borna in Richtung Zwickauer Mulde eine Vielzahl von Burgen, Schlössern und Rittersitzen. Eine der Voraussetzungen zum Bau der Burgen war die bäuerliche Erschließung der Region. Bereits 1105 existierten im Gebiet zwischen der Wiera und der Schnauder (Region Groitzsch-Altenburg-Kohren) 17 Dörfer, die den sogenannten „Neubruchzehnten“ zahlen mussten. (O.U. vom 23. Sept. 1105). Zu der Zeit war die weitere Erschließung des Gebietes bis hin zur Zwickauer Mulde in vollem Gange, wie das aus dem Urkundentext hervorgeht. Anfang/Mitte des 12. Jahrhunderts waren ja noch etwa fünf bis sechs Bauernfamilien nötig, um so viel Überschuss zu erzielen, um auch nur einen einzigen Burgenbauer oder späteren Burgbewohner zu ernähren. Die Burganlagen wurden, wenn irgend möglich als Höhenburgen errichtet um sich vor feindlichen Angriffen zu schützen, wie z.B. die Wolkenburg oder die Rochsburg. In Kaufungen war dies nicht möglich, deshalb wurde sie als Wasserburg angelegt und mit doppelten Wallgräben umgeben. Das Datum der Entstehung dieser Burg, die von den von Kaufungen errichtet wurde, ist nicht bekannt, denn eine Gründungsurkunde existiert nicht. Laut Original-Urkunde vom Juli 1226 könnte sie aber um 1170 errichtet worden sein. In dieser Urkunde, ausgestellt in Verona, wird ein Heinrich von Kaufungen von Kaiser Friedrich II. direkt mit Kaufungen belehnt, das er zuvor, vermutlich als Erbteil zusammen mit seinem Bruder Guelferamus (zu der Zeit verstorben), besessen hatte. Über das Aussehen der Burg ist nichts bekannt, da sie im Bruderkrieg 1450 schwer beschädigt, 1535/36 abgebrochen und daneben neu aufgebaut wurde. Man kann aber davon ausgehen, dass sie in der damals üblichen Bauweise mit Bergfried, Wehrmauer, Torturm, Fallbrücke usw. errichtet wurde. Zeugnisse aus jener Zeit sind nur noch Bodenfunde, wie Metallteile oder Keramikscherben, von der Bausubstanz ist absolut nichts mehr vorhanden. Im Besitz der von Kaufungen, die vermutlich aus dem hessischen Kaufungen nach Sachsen gekommen waren, verblieb die Burg bis zum legendären Prinzenraub des Kunz von Kaufungen im Jahre 1455. Kunz hatte schon vor seiner Hinrichtung am 14. Juli 1455 (er wurde in der Kirche von Neukirchen begraben), seinen Besitz Kaufungen mit der Wolkenburger Mühle an Hans von Maltitz verpfändet, der dann auch im Besitz von Kaufungen verblieb. Unter den Maltitzern, im Besitz von Kaufungen bis 1557, wurde die Burg neu errichtet. Auf die Maltitzer folgten die von Pflugk, die von Thumbshirn und die Edlen von der Planitz. Die Erben des letzten Planitzers verkauften Kaufungen im Jahre 1766 an Detlev Carl Graf von Einsiedel auf Wolkenburg. Dieser lässt den gesamten Gebäudekomplex einschließlich der Kirche renovieren, wie aus einer Urkunde hervorgeht, die in den Turmknopf des nun so genannten „Schloss Kaufungen“ eingelegt wurde. Es heißt dort u.a.: „… dass … dieser Bau aber endlich mit Aufsetzung des Knopfes d. 25. September 1767 gedachten Jahres zu Stande gebracht worden“. Detlev Carl Graf von Einsiedel plante unterhalb des Gebäudekomplexes eine Parkanlage mit drei Pavillons zu errichten, was aber dann doch nicht zur Ausführung kam. Der Bau existierte bis 1945 im Wesentlichen unverändert, ab diesem Jahr riss man nahezu den gesamten Gebäudekomplex einschließlich der Rittergutsbrauerei ab und verwendete das Abbruchmaterial zum Bau von Neubauernhäusern. Stehen blieb nur ein rechtwinklig angeordneter Wohnflügel mit Treppenturm. Dieser wurde vor einigen Jahren in Privatbesitz übernommen und denkmalgerecht saniert.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 11. Mai 2017 -
Die Holzmühle (Teichmühle, Richtermühle) in Rußdorf
Die Holzmühle (Teichmühle, Richtermühle) in Rußdorf
Dr. H. Schnurrbusch –
aus dem Heft „Mühlen am Limbach und am Frohnbach“ © 2016
Das Dorf Rußdorf (1335 als Rudelsdorf genannt) war 1457 bis 1928 eine Enklave im Gebiet Sachsens und gehörte zum Kreisamt Altenburg. Es war durch einen Tausch zum Herzogtum Sachsen-Altenburg, ab 1920 Thüringen gekommen. Da das Dorf keine eigene Mühle hatte, mussten die Rußdorfer Bauern ihr Getreide „im Ausland“ mahlen lassen, was durch Behinderungen und höhere Kosten Ärgernisse verursachte. Jeder Ort außerhalb der Flurgrenzen des Dorfes war für die Rußdorfer Ausland, nämlich Sachsen.
Über vier Jahrhunderte war die Familie der Erbgutbesitzer, Gastwirte und Richter Sebastian in Rußdorf ansässig. 1719 hatte der Antrag von Elisabeth, der Witwe des Dorfrichters Abraham Sebastians, Erfolg, und sie erhielt von Friedrich III., Herzog zu Sachsen-Gotha-Altenburg, die Konzession zum Betreiben einer Wassermühle mit einem Mahlgang, für ein „Ausspann- und Schänkgut mit Mühle“. Deshalb findet man mitunter die Bezeichnung „Richter-Mühle“, nicht nach einem Namen, sondern nach dem Dorfrichter benannt. Die Kopie der Konzessionsurkunde befand sich früher im Heimatmuseum Limbach. Allerdings konnte die Witwe nach den Zunftbestimmungen die Mühle nicht selbst betreiben, sie wurde verpachtet. Neben der Mühle wurden eine Bäckerei und eine kleine Gastwirtschaft eingerichtet, Brot und Kuchen gebacken und Sebastians Bier ausgeschenkt. Mühlenpächter und Bäcker waren 1753 Bernhard Müller, 1768 Benjamin Teubel, 1802 Adam Wagner, 1825 Friedrich Wetzel, 1853 Heinrich Baumann und 1875 als letzter Ernst Seifert.
Die Mühle wurde im Quellgebiet des Frohnbaches am Rußdorfer Holz an der Süd-grenze der Flur erbaut. Die Lage ist noch zu ersehen im Oberreitschen Atlas, der ältesten Generalstabskarte Sachsens von 1821-1860. Vom „Kober“ führt ein „Mühl-weg“ zu dem Dreiseiten-Gehöft in Fachwerkbauweise auf massivem Erdgeschoss.
Der Kuwer oder Kober bezeichnet das Ende der Rußdorfer Flur in Richtung Meins-dorf, also an der südlichen Meinsdorfer Straße. Das Haupt- und das Mühlen-gebäude mit dem Schuppen für das Mühlrad standen nach Süden, dem Teichdamm zu, hinter dem Haus, nach Rußdorf zu befand sich das Stallgebäude, nach Limbach zu die Scheune. An der Meinsdorfer Seite war das Gehöft durch Mauer und Tor versperrt.
Da der Frohnbach dort nur ein kleines Rinnsal ist, wurden zum Mühlenbetrieb erst ein, später noch zwei Mühlteiche angelegt und das Rußdorfer Korn gemahlen. Die Holzmühle wurde zu einem beliebten Ausflugsziel der Limbacher Wanderer und der Pilzsucher. Paul Fritzsching hat sich 1938 noch von alten Limbachern berichten lassen:
„…Draußen bei der Mühle waren Bänke und Tische aufgestellt. Bier gab’s in Fla-schen, in den früheren Tonflaschen: Weißbier, auch Gose. Auch einen Schieböcker konnte man kriegen, Würsteln, auch ein Glas Milch. Stufen gingen auf den Teich-damm hinauf. Von dort sah man das Mühlrad bei der Mühle.“ … „Dort wurde ge-wöhnlich eingekehrt, wenn wir in die Pilze gingen. Beim Bäck’ Seifert gab’s eine gute Flasche „Einfach“ (Bier) aber auch Kuchen und Kaffee. Im Grätzegarten zog er be-sonders viele schöne Rosen…“
Leider verfiel die Mühle um 1870 immer mehr, der letzte Pächter kündigte 1875 sei-nen Vertrag, 1878 wurde die Holzmühle abgerissen. Ihr Dasein wurde vergessen, nur der Mühlweg und die Mühlteiche erinnern noch an die Rußdorfer Holzmühle.
1)Der Rußdorfer „Großbauer“ Ch. Sebastian floh 1956, von der Kolchosierung bedroht, mit seiner Familie nach Kanada, aus seinem Besitz wurde die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft LPG Typ I. Während der „Kollektivierung“ der Landwirtschaft in der DDR 1952 bis 1960 begingen etwa 200 Bauern Selbstmord, 15.500 flohen in den Westen, es fanden 8.000 Schauprozesse statt.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 27. April 2017 -
Heinrich Mauersberger
Heinrich Mauersberger
Friedemann Bähr
Am 16. Februar erinnern wir uns des 35. Todestages von Heinrich Mauersberger, geboren am 11. Februar 1909 in Neukirchen bei Crimmitschau, der sich mit seinem großen Erfindergeist zu DDR-Zeiten einen nachhaltigen Ruf erwarb, vor allem mit seinem geschützten DDR-Patent „WP 8194“ zur Nähwirktechnik, dem später weitere 67 anerkannte Patente folgten. Heinrich Mauersberger bleibt uns als stets hilfsbereiter und bescheidener Mann mit Witz und Humor in Erinnerung, der lebenslustig und immer freundlich und durch seinen beharrlichen Einsatz für den technischen Fortschritt weltweite Anerkennung fand. Der Chemiker-Colorist, Handwerksmeister, und Textilingenieur entwickelte zusammen mit Textilmaschineningenieuren den Prototyp einer Nähwirkmaschine vom Typ Malimo in seiner Garage. Das wichtigste Teil seiner Erfindung war eine neuartig geformte Nadel, für deren Herstellung er spezielles Werkzeug aus einer Metallfabrik benötigte. Um Tag und Nacht an seiner Erfindung weiterzuarbeiten, hatte er sogar sein Nachtlager gleich neben der Werkbank eingerichtet und kam dadurch zu dem Spitznamen „Wattegeist“. Das Urmodell ist heute im Museum in Bonn zu bewundern, nachdem es Mauersberger 1975 dem Deutschen Museum für Geschichte in Berlin übergab und nach der politischen Wende war es vorübergehend im Technischen Museum München untergebracht. Die Serienproduktion der entsprechenden, sehr produktiven Maschine begann vor genau 60 Jahren, im Jahre 1957 in Karl-Marx-Stadt. Diesem folgten weitere Entwicklungen, so die abgewandelten Typen Malipol, Maliwatt und Malivlies, die ebenfalls Ende der 50er Jahre von sächsischen Unternehmen hergestellt wurden. Malimo (zusammengesetzt aus Mauersberger Limbach-Oberfrohna) revolutionierte die Textilindustrie der DDR und wurde in großen Mengen hergestellt. Malimo-Maschinen wurden in zahlreiche Länder exportiert (unter anderem nach Australien, Dänemark, Frankreich, Island, Japan, Kuwait, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und USA). Malimo-Erzeugnisse fanden sich später in fast allen Privathaushalten der DDR. Typische Produkte waren Handtücher und Gardinen. In der Gegenwart hat das Verfahren zur Herstellung technischer Textilien Bedeutung. Außerdem wird heute noch seine Nähwirktechnik in der Industrie sowie in der Raumfahrt genutzt. Der DDR-Slogan „Der Meister sprach von Malimo, denn Malimo hat Weltniveau“ machte die Runde und Malimo Maschinen und Lizenzen wurden ist fast 80 Länder verkauft. Heinrich Mauersberger erhielt für seine Erfindung in der DDR 1954 den Nationalpreis III. Klasse für Wissenschaft und Technik, erhielt 1963 den Ehrentitel „Held der Arbeit“ und ein Jahr später den Orden „Banner der Arbeit“ Der Rat der Stadt Limbach-Oberfrohna verlieh ihm im Jahre 1963 die Ehrenbürgerschaft und eine Straße, der Heinrich-Mauersberger-Ring, ist nach ihm benannt. Auch im Ausland wurde Heinrich Mauersberger für seine Erfindung ge-ehrt. So wurde er am 29. November1979 zum Ehrenmitglied des Textile Institute of Manchester ernannt. Diese Ehre wurde vor ihm erst einem Deutschen, dem Erfinder des Perlons, Paul Theodor Schlack, im Jahre 1963 zuteil: Auf der Leipziger Messe gelang ihm der Verkauf einer Lizenz an die USA. Nachdem Heinrich Mauersberger trotz großem physischen Druck nicht in die SED eintrat, erlag er den Repressalien, wurde aus der „Kammer der Technik“ ausgeschlossen, erhielt Redeverbot auf fachlichen Symposien und Konferenzen. Nach seinem energischen Protest verlor der Entwicklungsingenieur seine Stellung in der VVB Textima als Malimo-Institutsleiter und wurde für drei Monate in die Psychiatrie nach Waldheim gebracht. Nach seiner Entlassung verzog er nach Berlin und erwarb vor 50 Jahren, im Jahre 1967, ein Anwesen in Bestensee und hatte kein eigenes Einkommen mehr; die Malimo-Lizenzeinnahmen seines Patents wurden ihm nicht ausgezahlt. Nachdem 1969 einige westdeutsche Kollegen aus seiner Branche in einer Fachzeitschrift mit dem Solidaritätsaufruf: „DDR-Erfinder nagt am Hungertuch“ an die Öffentlichkeit traten, erhielt Mauersberger eine Ehrenpension des Ministerrates, deren Höhe auch nach der Wende nicht ermittelt werden konnte, denn die DDR vereinnahmte seine gesamten Lizenzentgelte. Heinrich Mauersberger verstarb 1982 an seinem letzten Wohnsitz in der brandenburgischen Gemeinde Bestensee und wurde auf dem Nordfriedhof beigesetzt. Die Gemeinde Bestensee machte ihm postum am 5. Februar 2009 zum ersten Ehrenbürger der Kommune.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 16. Februar 2017 -
Edelkastanie oder Marone in Rußdorf
Edelkastanie oder Marone in Rußdorf
Waldenburger Straße 157
Friedemann Maisch, im Auftrag des Fördervereins Esche-Museum
Wie der Besitzer des Vierseitenhofes Gotthardt Fichtner (1929 - 2015) berichtete, wurde die Marone vor vielen Jahren von Bauern dort gepflanzt. Sie war in alten Zeiten als Setzling aus dem Altenburgischen nach Rußdorf gelangt. Rußdorf war ja seit 1525 herzoglich thüringische Enklave mitten im Königreich Sachsen. Gotthardt Fichtner war 1945 kurz vor Zwölf als blutjunger Mann durch die Wehrmacht als Soldat eingezogen und durch die Kriegswirren schließlich in amerikanischen Kriegsgefangenschaft gelangt. Der ursprünglich etwa 200 Jahre alte Baum war beim Brand des Vierseitenhofes am 14. April 1945 eingegangen. Die Ursache des Brandes war die fanatische und unsinnige Gegenwehr der Wehrmacht beim Vorrücken der amerikanischen Truppen. Von Falken aus nahmen die Amerikaner daraufhin Rußdorf unter Artilleriefeuer. Elf Häuser beziehungsweise Gehöfte in Rußdorf wurden am 14. April 1945 in Brand geschossen, so auch der Fichtnersche Vierseitenhof an der Waldenburger Straße. Bei den Kämpfen kurz vor Kriegsende starben 16 Soldaten und Zivilisten. Gotthardt Fichtner erlebte bei der Heimkehr aus amerikanischer Gefangenschaft neben dem ausgebrannten Vierseitenhof die ehemals prächtige Edelkastanie als kümmerliche verkohlte Baumleiche. Man schnitt den Stamm bis auf den Baumstumpf zurück. Aber, oh Wunder, die Wurzel der Edelkastanie trieb bald wieder aus. Heute ist das ein vielstämmiger Baum. Jedes Jahr im Juni treibt der hier seltene Baum üppige Blüten in Form weißer Rispen – eine große Anziehung für Bienen und andere Insekten. Die Blüten der Edelkastanie liefern reichlich Nektar. Die Blütenrispen sind bis Anfang Juli zu bewundern. Die Früchte, die Maronen, können geröstet und gegessen werden. So gesehen ist diese Edelkastanie in unserer Gegend eine botanische Seltenheit und zugleich ein Überbleibsel aus alter Zeit.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 5. Januar 2017 -
Wie Rußdorf bald einen Bahnhof bekommen hätte
Wie Rußdorf bald einen Bahnhof bekommen hätte
Hans Lange
Im 8. Schuljahr meiner Schulzeit musste ich folgende Nachschrift schreiben: Zu unserer Großväter Zeiten waren im Bahnverkehr noch sehr viele Fremdwörter üblich. Damals unternahm man keine Reise, sondern eine Tour. Man ging nach der Station (Bahnhof), löste ein Billet (Fahrkarte) oder manchmal auch gleich ein Retourbillet (Rückfahrkarte), sah sich nach einem Portier (Pförtner) um, der natürlich Uniform (Dienstkleidung) trug, fragte diesen noch einmal nach dem Kurs (Fahrplan), ging auf den Perron (Bahnsteig) und bestieg ein Kupee (Abteil). Während der Fahrt kletterte der Kondukteur (Schaffner) von Waggon zu Waggon (Wagen), kontrollierte (prüfte) und kupierte (lochte) die Billets. Die Passagiere (Fahrgäste) konnten auch Lokalzüge (Vorortzüge) benutzen. Die Straßenübergänge waren fast nirgends durch Barrieren (Schranken) gesichert.
Um die Jahrhundertwende entwickelte sich das Limbacher Gebiet zum wohl wichtigsten Textilzentrum Sachsens. Da war es mehr als angebracht, das Eisenbahnnetz entsprechend zu erweitern. Der Limbacher Stadtrat hatte aus diesem Grunde oftmals die Bahnprojekte auf der Tagesordnung, weil die Verbindungen nach Chemnitz und Wüstenbrand unzureichend erschienen. Relativ früh verwarf man die Bahnverbindung nach Penig, die die sächsische Regierung schon zweimal bewilligte, aus Mangel an Geld aber nicht zustande kam. Sie wäre wichtig gewesen, um Kohle von Lugau nach dem sächsischen Norden zu transportieren. Bahnhöfe wären entstanden in Oberfrohna, Fichtigsthal, Mittelfrohna, Niederfrohna, Mühlau, Tauscha, Kaufungen und Wolkenburg. Dann wäre die Linie in die Muldenbahn eingemündet. Grumbach, Callenberg und Rußdorf kämpften um eine Bahnverbindung Limbach – Sankt Egidien. Dieses Projekt kam jedoch nicht an, weil es nur wenig Unterstützung fand. Die Limbacher entschieden sich mehr und mehr für eine Eisenbahnverbindung nach Gößnitz.
Ende des Jahres 1911 stimmte man einer Bahnverbindung Limbach – Meerane zu. Das ergab aber riesige Probleme, weil der Bau eines Viadukts bei Waldenburg sehr kostspielig geworden wäre. Schließlich war man sich einig über die Linie Limbach – Waldenburg – Gößnitz. Vermessungen ergaben die stärkste Neigung von 1 : 40, und Bahnhöfe wären entstanden in Oberfrohna, Rußdorf, Falken, Langenchursdorf, Callenberg, Ebersbach, Waldenburg, Schwaben, Niederwiera, Tettau, Köthel und Gößnitz. Die Kosten wurden mit 5.900.000 Goldmark veranschlagt. Letzten Endes wurde die Linie Limbach-Oberfrohna am 1. Juli 1913 eröffnet, zu deren Bau Oberfrohna 200.000 Mark beisteuern musste. Alle anderen Projekte starben mit dem Beginn des 1. Weltkrieges.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 29. September 2016 -
Baumeister
Baumeister
Dr. H. Schnurrbusch - aus dem Heft „Dies und das“ © 2013
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert gab es in den Städten Limbach und Oberfrohna einige hervorragende Baumeister und Architekten. Die Berufsbezeichnung „Baumeister“ wurde damals übergreifend verwendet für die Tätigkeiten von Architekten und Bauingenieuren mit einer Ausbildung an Hochschulen oder Fachschulen. Baumeister hatten bei Bauvorhaben die technische und administrative - manchmal auch die künstlerische - Leitung. Kern der Tätigkeit war die Bauausführung.
Erst später ergab sich mit der zunehmenden Komplexität des Bauwesens eine Differenzierung. Die Berufsfelder der Architekten, der Bauingenieure (heute in allen akademischen Graden vom Dr. Ing. bis zum Bachelor in den verschiedenen Baufächern wie Hoch-, Tief-, Brückenbau u.a.) oder Projektmanager entstanden und unterschieden sich. Immer handelt es sich um staatlich geprüfte Bausachverständige. Unabhängig davon gab in der Branchenbezeichnung „Bauunternehmer“, was nichts über dessen Qualifikation aussagt, sondern den Eigentümer eines Baugeschäfts benennt. Ein Bauunternehmer konnte Baumeister, Architekt oder Bauingenieur sein, mitunter war er Maurer- oder „Baugewerksmeister“. Die Baumeister in Limbach und Oberfrohna haben das Bild der Stadt mit vielen, heute noch ansehnlichen Bauwerken geprägt, wenn auch ihre Schöpfer oft vergessen sind. Es finden sich derzeit noch stattliche Bauten aus der Gründerzeit, dem Jugendstil oder der neuen Sachlichkeit bis hin zum Heimatstil von Siedlungsbauten im „Dritten Reich“. Auffallend ist, dass bei allen Bauwerken ansässige Firmen arbeiteten, die damit hiesige Arbeitsplätze sicherten. Eine deutschland- oder europaweite Ausschreibung wäre undenkbar gewesen. Allerdings sind manche Bauten nicht ohne Fehlschläge entstanden. So stürzte Ostern 1927 bei einem Erweiterungsbau der Fa. Ernst Saupe (später Wima) ein Teil der Fabrikhallen mit Getöse zusammen. Zum Glück kamen Personen nicht zu Schaden. Anders 1932: Am 15. November stürzte beim Bau des Kinos „Capitol“, Helenenstraße 49, eine neu errichtete Ziegelmauer ein und begrub drei schwer verletzte Bauarbeiter unter sich.
So gehören am Anfang des 20. Jahrhunderts zu den Limbacher Baumeistern Poser, Vater und Sohn, die ganze Straßenzüge, das Hotel „Stadt Mannheim“, die Kaiserliche Post am Ludwigsplatz, die Schulen I und II und die Oberfrohnaer Kirche gebaut haben.
Die Christophstraße ist nach dem Vater Christoph Poser benannt. Die Firma des Baumeisters Sussig erbaute u.a. zahlreiche Straßenschleusen, den Schlachthof, zwei Turnhallen, das Fabrikgebäude von Louis H. Schaarschmidt sowie Kirche und Schule in Kändler, Guido Zetsche erweiterte 1927 und 1935 die Fa. Ernst Saupe. In Oberfrohna war die Baufirma Hermann Täschner tätig und errichtete u.a. das Pfarrhaus, den Schulhausanbau, das Jahnhaus und viele Wohnhäuser. Um 1925 stehen im Branchenverzeichnis unter der Rubrik Baumeister, Architekten, Baugeschäfte in Oberfrohna die Firmen Täschner, Schönert (heute Rühlig) oder Thieme und in Limbach Perl, Zetsche, Poser, Sussig, Fischer, Johne, Süß, Schramm, (Grobe &) Vogelsang und andere. Es bedürfte einer eingehenderen Würdigung dieser geschäftigen Männer. Um 1930 taucht der Name des Limbacher Architekten Hans Möckel (1908 – 1942) auf.
Nicht vergessen sein sollen die fähigen Stadtbaumeister, Hermann Haupt - in Limbach als Baurat tätig vom 16.4.1923 bis zum 30.4.1940 - und Oswin Haas in Oberfrohna. Haupt projektierte z.B. den Wasserturm und die Siedlung Am Quirlbusch, den Umbau einer Fabrik zur Berufsschule und viele Wohnbauten. Erstaunlich ist, dass die Stadtplanung dieses Bauamtsleiters schon 1931 die Bebauung der heutigen Wohngebiete Am Hohen Hain und Am Wasserturm vorsah, das heutige Gewerbegebiet Ost und seine Verkehrsplanung Ortsumgehungen mit einer nördlichen und südlichen Ringstraße.
Der Stadtbaumeister Oswin Haas war im Bau- und Grundstücksamt Oberfrohna seit dem 16.11.1925 beschäftigt und entwarf das Gebäude der „Volksküche“ (Rußdorfer Straße 6) in Oberfrohna und ließ Wohnhäuser errichten. In seine Amtszeit und Leitung fiel der Bau der Jahnkampfbahn, der Oberfrohnaer „Randsiedlung“ (Gartenstraße, Am Birkenhain) und der Siedlung an der Wiesenstraße. Bei der Ausstellung „Sachsen am Werk“ wurde Oberfrohna 1938 auch wegen seiner Leistungen als „Musterstadt“ geehrt.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 18. August 2016 -
Alte Bäume im Limbacher Land – einst und jetzt Die Edelkastanie oder Marone in Pleißa
Alte Bäume im Limbacher Land – einst und jetzt
Die Edelkastanie oder Marone in Pleißa
verfasst im Auftrag des Fördervereins Esche Museum von Friedemann Maisch
Edelkastanien sind im sächsischen Vorgebirgsland auch heute noch Exoten. Die wärmeliebenden Bäume stammen aus den Mittelmeerländern und sind z.B. in Südtirol weit verbreitet. Wer hat wohl noch keine gerösteten Früchte der Edelkastanien – die Maronen probiert? Wie dieser Exot nach Pleißa geraten ist, kann nur vermutet werden. Das Dorf Pleißa gehörte nicht zum Besitz des Limbacher Rittergutes bzw. des Amtes Penig, sondern zum „Closter Kempnitz“ und nach der Reformation zum Kirchsprengel Chemnitz. Der Vierseitenhof, das spätere Forstgut war lange Zeit im Besitz der unterhalb der Kirche gelegenen Oehm-Mühle und wurde 1789 an einen Kretschmar, von Beruf Grenzschütze, verkauft. Es ist zu vermuten, dass die Müller der Oehm-Mühle eine bessere Bildung hatten wie die Bauern und sie über Kaufleute Verbindungen zu fernen Gegenden knüpfen konnten und dass damit eine seltene Edelkastanie als Exot den Weg nach Pleißa fand. Diese wurde dann im Garten des Bauerhofes gepflanzt. Der Vierseitenhof wurde von der sächsischen Krone gekauft, war dann von 1855 bis 1871 als Forstgut das Domizil der Oberförster. Diese waren direkt dem sächsischen Hof unterstellt. Zu erwähnen ist, dass der Luftfahrtpionier Georg Baumgarten bis 1871 hier Oberförster war. Von der alten Forstgut-Zeit künden heute noch einige verwitterte Geweihe am Giebel des Wohnhauses. Die Familie Reichenbach erwarb das ehemalige Forstgut 1928. Der starke Stamm der Marone war nur 2,40 Meter hoch, dann begann schon die mächtige weitausladende Krone. Der Stammumfang hatte, wie der Chronist Paul Fritsching in den 1920er Jahren berichtete, stattliche 4,10 Meter betragen. Das Alter kann nur anhand des Stammumfanges geschätzt werden. Vergleichbare Bäume in unserer Klimazone wären mindestens 200 Jahre alt. Die Marone erschien so breit wie hoch. Die Blätter sehen ganz anders aus, wie z.B. bei einer gewöhnlichen Kastanie. Mehr länglich lanzenförmig und gezähnt. Der kalte Polarwinter 1928/29 gab der alten Edelkastanie den Rest. Im Jahre 1930 waren dann nur noch wenige Äste mit Blattgrün vorhanden. Stürme brachen schließlich den Stamm. In der Umgebung des Forstgutes finden wir eine Ansammlung von wertvollen alten Laubbäumen. Darunter zahlreiche Linden, Kastanien und Eschen. Nun haben wir nur noch wenige Maronenbäume im Limbacher Land. Sie stehen z.B. an der Goetheschule, im Park des alten Krankenhauses und in Rußdorf beim Bauer Fichtner. Ein Methusalem unter den Maronen ist in Gersdorf bei Nossen zu finden. Hier beträgt der Stammumfang des alten Baumes 8,25 Meter. Der Baum befindet sich allerdings im absterbenden Zustand.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 21. Juli 2016 -
Das historische Ortsbild von Bräunsdorf
Das historische Ortsbild von Bräunsdorf
Siegfried Frenzel
Wer von Chemnitz her mit dem Auto kommend die Stadtteile Limbach und Oberfrohna in Richtung zur Zwickauer Mulde hinter sich gelassen hat, dem bieten sich nach etwa 300 Metern beim sogenannten „Wegweiser“ – eine alte dreikantige Steinsäule – drei Möglichkeiten weiter in andere Stadtteile von Limbach-Oberfrohna zu fahren. Entweder wählt man den rechts abbiegenden direkten Weiterweg über Kaufungen zur Mulde bei Wolkenburg oder man fährt geradeaus weiter. Gleich links ging es durch die Oberfrohnaer Siedlung zum Bräunsdorfer Oberdorf hinein. Wer geradeaus weiter fährt, dem breitet sich sogleich nach einer kleinen Anhöhe das idyllische, wie in einer Schüssel liegende, Dorf vor sich aus. Es ist die grüne Pforte zum Muldental, dem Land der Burgen Waldenburg, Wolkenburg, Rochsburg, Wechselburg und andere, einer der schönsten Landschaftsräume unserer Heimat.
Entlang des Bräunsdorfer Baches windet sich der Ort etwa vier Kilometer bis zum Ortsausgang vor dem Leitenholz. Bauernhöfe wurden links und rechts des Baches angelegt. Es ist ein typisches Reihen- oder Waldhufendorf, wo jeder Hof einen eigenen Besitzstreifen rechtwinklig zu Straße und Bach hat. Die Siedler brachten im Mittelalter diese Dorfform aus ihren Ursprungsländern mit und rodeten den darauf stehenden dichten Wald (Miriquidi). So entstanden Nutzflächen.
Zwischen und vor die Höfe der Bauern haben sich im Laufe der Zeit Häusleranwesen gedrängt. Auch ein Rittergut gab es. Der große Dorfteich im Niederdorf liegt eingebettet in der breiten Aue, die in ihrer Ursprünglichkeit unbebaut geblieben ist. Dies ist eines der wesentlichen Merkmale der Waldhufendörfer. Unterhalb des großen Teiches schaut man hinauf zum Kirchberg mit der neuromanischen Kirche. Auch hier scheint die Gestalt des Ortes wie zu dessen Anfängen zu sein. Eine stetig fortlaufende Bebauung hat es auch hier nicht gegeben. Die typischen Hausformen im Ort brachten die ersten Siedler aus ihrer Heimat mit. So sind eine Reihe schöner Fachwerkhäuser erhalten. Allerdings häufig angepasst und auch erneuert. Der besonders interessierte Betrachter findet noch Oberlaubengänge und kunstvoll gestaltete Andreaskreuze im Fachwerk. Auch der Dorfbach in seinem ursprünglichen Bett ist fast überall unberührt geblieben. Wie selbstverständlich nimmt er seinen Lauf durch den Ort. Nur im Mitteldorf waren bescheidene Ufermauern zur Hochwasserbändigung notwendig. Durch mehrere Mühlen im Ort und die einst groß angelegte Leinwandbleicherei sind noch Teiche und Rudimente künstlicher Gräben erhalten.
Bräunsdorf ist von alters her landwirtschaftlich geprägt. Über einige Jahrhunderte war der Anbau von Flachs, dessen Weiterverarbeitung und Handel damit eine bedeutende Erwerbsquelle. Später kamen Strumpf- und Textilindustrie mit einigen Fabriken dazu. Im Gegensatz zu anderen Orten ist die ursprüngliche Dorfform noch ablesbar erhalten. Dies ist ein besonderer Schatz.
Heute gibt es im Ort Gebäude für Landwirtschaft, Handwerk und Wohnen, eine Gaststätte in der ehemaligen Teichmühle, einen Bäcker und einen Fleischer im Mitteldorf und im Niederdorf einen Mini-Lebensmittelladen. Sehenswert ist die Kirche. Bräunsdorf mit zirka 1100 Einwohnern seit 1998 Ortsteil von der Großen Kreisstadt Limbach-Oberfrohna. Das heutige Erwerbsleben wird durch die Landwirtschaft, die Dienstleistungen und das Auspendeln zur Arbeit in die Nachbarstädte bestimmt. Bräunsdorf gehört zu den schönsten und aktivsten Orten Westsachsens, was einst durch Wettbewerbsteilnahme bestätigt wurde.
Bemerkenswert ist, dass in unserem Dorf heute und wohl auch in Zukunft die Dominanz der Landwirtschaft geblieben ist. Sofort nach der Wende 1990 machten sich viele Bauern wieder selbstständig als sogenannte „Wiedereinrichter“. An und in mehreren Höfen sind moderne Ställe für Rinder gebaut worden und das Landschaftsbild verändert sich durch große Weideflächen.
Eine von mir 1985 gestaltete Orientierungstafel gibt eine Übersicht vom Ort. Sein steht unweit vom Rathaus entfernt. Für „Wanderlustige“ sollte sie ursprünglich sein. Da die DDR-Werkstoffe aber der Witterung nicht lange standhielten, musste ich sie schon Anfang der 1990er Jahre erneuern. In der Nachwendezeit hat sich durch Bebauung im Dorf so viel verändert, dass eine erneute Überholung durch einen kompetenten Betrieb erforderlich wurde. Für mich erfreulich ist, dass mein ursprünglicher Gestaltungswille, Bräunsdorf als „heimatliche Scholle“ mit jedem Haus und Bauerngut darzustellen, beibehalten wurde.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 7. Juli 2016 -
1927: 100 Jahre Schule in Oberfrohna
1927: 100 Jahre Schule in Oberfrohna
Dr. H. Schnurrbusch: Aus der Schulgeschichte Oberfrohna ©1996
Für Oberfrohna gibt es 1927 gleich zwei Anlässe zum Feiern: Der Schulanbau wird fertig und es ist 100 Jahre her, dass die Gemeinde überhaupt eine Schule hat. 1827 hatte ja der Strumpfwirker und Katechet Krauße zum ersten Male in der Hauptstraße 63 Schule gehalten. Das Freudenfest wird für Sonntag, den 10. Juli, in der Tradition früherer Fest wieder so vorbereitet, dass das ganze Dorf mitfeiern und sich mitfreuen kann.
Einen Tag vor dem erwarteten Freudentag ereignet sich aber die Unwetterkatastrophe vom 9. Juli 1927. Am Nachmittag dieses Sonnabends gegen zwei Uhr verfinstert sich der Himmel, "dass man die Hand vor Augen nicht mehr sah". Heftige Gewitter mit wolkenbruchartigen Regenfällen kommen den Menschen "wie die Sintflut" oder "das Ende der Welt vor.“ Es strömen solche Wassermassen vom Himmel, dass die Dämme von Schimmels Teichen brechen und das ganze Frohnbachtal überschwemmt wird. An der oberen Hauptstraße stehen Häuser, bei denen das Wasser in die Fenster des Erdgeschosses auf der einen Seite hinein und auf der anderen wieder hinaus fließt. Bei der Firma Herrmann Dittrich steht ein ganzes Stockwerk mit allen Maschinen unter Wasser, der Hof der Firma Hermann Grobe gleicht einem See. Zäune und Brücken werden fortgespült und Keller überflutet. Auf der Hauptstraße schwimmen Holzstücke, Hausgerät, Hühner, Bäume. Der Wasserdruck schleudert die schweren eisernen Schleusendeckel heraus und beschädigt oder zerstört Gebäude. In den alten Schulhäusern an der Hauptstraße ober- und unterhalb der neuen Schule stehen die Erdgeschosse unter Wasser, Möbel und Hausrat werden mit Schlamm bedeckt, alle Einrichtung verdorben. Die alte, aus Lehmziegeln erbaute Schmiede bricht zusammen. Die Einwohner müssen mit großer Mühe von der Feuerwehr aus dem oberen Stockwerk gerettet werden. Selbst in Mittelfrohna überfluten die Wasser des Frohnbachs noch über einen Meter hoch die Straße. Am wenigsten lassen sich die Kinder erschrecken, sobald die erste Gefahr vorbei ist, waten sie in knietiefem Wasser und Schlamm auf der Hauptstraße umher und fischen mit großer Freude nach umher schwimmenden Gegenständen. Der Platz vor der Schule, sorgsam festlich geschmückt und mit Sand bestreut, ist völlig mit Wasser und Schlamm bedeckt - die Feier muss verschoben werden. Die Gemeinde Oberfrohna ist durch die Unwetterschäden schwer mit-genommen, trotzdem soll der Anlass würdig begangen werden. So einigt man sich auf einen Festakt am 12. Juli 1927 in der neuen Aula.
Auch ein Festumzug findet zum 100-jährigen Schuljubiläum statt. Ein Teilnehmer berichtet davon, dass die Oberfrohnaer Schulkinder ihre Rolle dabei zu spielen hatten. Ein Schock (60 Kinder) von ihnen stellt dabei Stahl-Schreibfedern dar. Auf einem Festwagen wird die erste Schulstunde in Oberfrohna 1827 gezeigt: Der Lehrer am Strumpf-Wirkstuhl und die Kinder aller Altersklassen in seiner Schulstube. Die Feierstunde in der Aula findet am Vormittag des 12. Juli 1927 statt. Sicher ist eine beschwingte Festfreude nicht aufgekommen. Der Schuldirektor Schramm umrahmt „in künstlerischer Weise“ die Feier mit Musik am Flügel. Er spielt u.a. Beethovens Andante aus der 5. Sinfonie und die Prometheus-Ouvertüre. Der Schulchor unter der Leitung von Oberlehrer Kurt Hartlich singt „Heimat und Vaterland“ und Schüler rezitieren Gedichte. Die Begrüßungsrede übernimmt der Bürgermeister Willy Böhme. Als Gäste sind u.a. erschienen der Regierungsrat Hampe, Oberschulrat Stenzel, Vertreter der Nachbargemeinden und -schulen, Gemeinderat und Schulausschuss, das Lehrerkollegium und die Bauleute. Böhme betont in seiner Rede, dass der Bau in Zeiten wirtschaftlicher Not und Krise der heimischen Industrie ein außerordentlich schweres finanzielles Opfer bedeutet, dadurch hätten die Gemeindevertreter aber auch das richtige Verständnis bewiesen für das Schulwesen und das Wohl des Kinder. Der Bürgermeister dankt allen, die bei der Errichtung des Neubaus mitgeholfen haben, vom Ministerium über die Schulbehörde, den Schulausschuss bis zum Architekten Bohlig und allen Gewerken am Bau. Darauf trägt die Schülerin der Klasse 1 b Inge Ernst ein Gedicht vor - 10 Strophen zu je 6 Versen lang. Die Weiherede hält der Oberschulrat Stenzel und verweist auf die Vorgeschichte des Anbaus, auf Raumnot und wachsende Schülerzahlen. Er geht dann ein auf den Prozess der Industrialisierung, der durch „Technisierung, Manufaktur, Maschinen- und Großbetrieb, Trusts, Syndikate und Rationalisierung der Arbeit nicht ohne Einfluss auf das Seelenleben der in den Wirtschaftsprozess hineingerissenen Menschen blieb.“ Der Schulrat stellt fest: „Der Schwerpunkt des Lebens wurde auf die materielle Seite verlegt. Arbeit ist Sinn und Inhalt des Lebens dieser Menschen, Arbeit ist ihr Glauben, ihre Religion!“ Er fordert die Entwicklung von der Lernschule hin zur Arbeits- und Erlebnisschule, denn es käme nicht mehr nur auf das bloße Wissen an, sondern auf eigenes Denken (!). Stenzel weiht das Haus „als Stätte frohen kindlichen Schaffens“. Bürgermeister Böhme stellt das Haus in den Schutz der Gemeinde und gibt es mit Glückwünschen in die Hand der Schulleitung. Schuldirektor Alexander Schramm übernimmt die Schule mit Dankesworten und Hinweis auf das Gedächtnisjahr für Pestalozzi und Beethoven (beide 1827 gestorben). Dann hält Schramm den Festvortrag „100 Jahre Oberfrohnaer Schulgeschichte“, in dem er die bisherige Entwicklung des Oberfrohnaer Schulwesens ausführlich und mit Liebe zur Heimatgeschichte darstellt. Ein Gedicht und ein Musikstück beenden die „eindrucksvolle und schöne Feier“, wie das Limbacher Tageblatt schreibt.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 9. Juni 2016 -
Bomben auf Limbach und Oberfrohna
Bomben auf Limbach und Oberfrohna
Dr. H. Schnurrbusch - aus dem Heft „Dies und das“ © 2013
Der „Luftkrieg“ – der Kampf von Luftfahrzeugen gegeneinander oder die Bekämpfung von Bodenzielen aus der Luft – ist etwa 150 Jahre alt. Den ersten Luftangriff der Weltgeschichte führte Österreich 1848, als es von unbemannten Ballons aus Bomben auf Venedig abwerfen ließ. Im Ersten Weltkrieg wurden Lüttich und Antwerpen als erste Städte im August 1914 von einem deutschen Zeppelin bombardiert.
Während sich der Luftkrieg 1914 bis 1918 noch gegen militärische Ziele richtete, entwickelten sich Bombardements danach zu verbrecherischem Terror gegen Zivilisten (Nonkombattanten). Zwischen den Kriegen wurden Bomben vor allen in den Kolonien geworfen: 1922 bombardierten u.a. die Briten Ziele in Indien, im Irak (hier erwarb „Butcher Harris“ seinen Beinamen durch den Tod hunderter Zivilisten), die Franzosen bombardierten Syrien. 1935 setzten italienische Flugzeuge Senfgas gegen Zivilisten in Äthiopien ein – 17.800 tote Zivilisten. Im Spanischen Bürgerkrieg erprobten die Sowjetunion, Deutschland (Legion Condor) und Italien ihre Flugzeuge. Die Zerstörung des baskischen Guernica 1937 durch deutsche und italienische Flugzeuge forderte 300 Todesopfer und erregte Empörung im Gegensatz zu den Verbrechen in den Kolonien.
Der Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg begann mit der deutschen Bombardierung von Warschau 1939 (26.000 Tote) und setzte sich fort mit Rotterdam (800 Tote). Die „Luftschlacht um England“ führte zu einer Niederlage der Luftwaffe. Trotzdem gab es über 20.000 Tote allein in London („The Blitz“), im Stadtzentrum waren Tausende Gebäude beschädigt oder zerstört. Vom November 1940 an wurden deutsche Angriffe auf Industriezentren, ausgeweitet, so auf Birmingham, Coventry (1.200 Tote), Manchester, Sheffield und weitere. Im April 1941 bombardierte die deutsche Luftwaffe ohne Kriegserklärung das unverteidigte Belgrad (15.000 Opfer). Im August 1944 warfen 50 deutsche Kampfflieger Bomben auf Paris. Es wurden 213 Menschen getötet und 593 Gebäude getroffen. Die Aufzählungen sind unvollständig. Makaber war der irrtümliche Bombenabwurf durch deutsche Flugzeuge auf Freiburg im Breisgau im Mai 1940.
Die Angriffe der britischen Royal Air Force (RAF) auf deutsche Städte begannen im Mai 1940 mit 35 Bombern auf Mönchengladbach. 1942 ging die RAF dazu über, nachts große Bomberschwärme mit über 1.000 Maschinen nach Deutschland zu schicken, um durch Flächenbombardements Großstädte zu vernichten. Betroffen waren u.a. Köln („Millenium“ und weitere 261 Angriffe) und das Ruhrgebiet, Hamburg („Gomorrha“), Berlin („Thunderclap“), Dresden, Braunschweig, Heilbronn, Kassel, Koblenz, Magdeburg, Pforzheim, Nürnberg, Schweinfurt, Wuppertal, Würzburg und viele andere wurden großflächig zerstört. 1943 traten auch amerikanische Luftflotten (USAAF) in den Luftkrieg ein. Sie flogen am Tag auf Sicht Angriffe auf Ziele im Deutschen Reich, erlitten 1943 mangels Begleitschutz anfangs schwere Verluste durch die deutsche Jagdabwehr.
Insgesamt fielen dem Bombenkrieg der Alliierten etwa 600.000 deutsche Zivilisten (davon 75.000 Kinder) zum Opfer. Es war die ausdrücklichen Absicht Churchills, die Zivilbevölkerung zum Angriffsziel zu machen und die Luftangriffe so zu gestalten, dass eine möglichst hohe Anzahl Menschen dabei starben („moral bombing“). Die britische Area Bombing Directive „Anweisung zum Flächenbombardement“ 1942 beabsichtigte eine Demoralisierung der Bevölkerung und die Destabilisierung der Regierung.
Das Gegenteil war der Fall – die „Volksgemeinschaft“ solidarisierte sich mit der Regierung gegen den Feind. Die Bombardierung über tausend deutscher Städte 1940 bis 1945 ist historisch beispiellos und die größte Katastrophe auf deutschem Boden seit dem Dreißigjährigen Krieg. Eine Million Spreng- und Brandbomben fielen auf 30 Millionen Zivilisten. 7,5 Millionen Deutsche verloren ihre Wohnung, abgesehen von dem Verlust der seit dem Mittelalter gewachsenen Städte- und Kulturlandschaft. Den vorläufigen Höhepunkt der Kriegsverbrechen gegen Zivilisten – Frauen, Kinder, Alte - erreichten 1945 die amerikanischen Atombomben auf Hiroshima (160.00 Opfer), Nagasaki (80.000 Tote).
Die deutschen Luftschutzmaßnahmen waren nur wenig erfolgreich, hatten aber zur Folge, dass die am Ort verbliebene Bevölkerung – überwiegend Frauen und Kinder, die meisten Männer waren ja an der Front - viele Male im Monat in Todesangst die notwendigsten Habseligkeiten zusammenraffte, den schon gepackten Koffer ergriff und in den Luft-schutzraum eilte, um dort in Angst, Grauen und Verzweiflung bis zur Entwarnung auszuharren. In Limbach und Oberfrohna gab es 1944 rund fünfmal im Monat Fliegeralarm.
So auch am 29. Juni 1944 in der Zeit von 9:15 bis 10:15 Uhr. An diesem Donnerstag hatten sich 600 Hitlerjungen des Geburtenjahrgangs 1928/1929 aus Limbach und Umgebung zur Röntgenuntersuchung gestaffelt in der Hindenburgschule (Goetheschule) einzufinden. Als der Alarm ausgelöst wurde, fanden viele im Schutzraum keinen Platz mehr und rannten ins Freie, auf den Hohen Hain zu, in der Hoffnung, dort sicher zu sein. Drei fanden dort den Tod. Nach einem Bericht des Lehrers Rudolf Weber führten zur gleichen Zeit mehrere hundert Kinder der Schulen II und III (Pestalozzischule und Gymnasium) auf dem Sportplatz an der Feldstraße Sportwettkämpfe durch. Bei Fliegeralarm durfte niemand mehr auf der Straße sein. Die Kinder konnten also nicht mehr nach Hause geschickt werden und mussten in der Turnhalle ohne Luftschutzraum den Angriff abwarten. Die Kinder waren panisch, weinten und schrien vor Angst bei jeder Detonation, bis die Gefahr endlich vorüber war. Sie erinnern sich noch heute daran. Der Bombenabwurf der US-Air Forces dauerte nur wenige Minuten und geschah wohl im Zusammenhang mit einem Angriff auf Mitteldeutschland (Leipzig, Magdeburg, Köthen). Er forderte in Limbach sechs Todesopfer, davon drei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche und ein französischer Kriegsgefangener im städtischen Dienst.
24 Personen wurden verletzt, davon acht Männer schwer. Die Bomben fielen zum Glück nicht auf das Stadtzentrum, sondern auf die Gegend der Kreuzeiche, der Siedlung am Neuteich, in den Hohen Hain. Betroffen waren die Schrebergärten („Bodenreform“, „Waldesruh“) und das Pfarrbachtal sowie die Wiesen zwischen Bahnhof und Neuteich. Es wurden rund 300 Bombentrichter gezählt, etwa 5 Meter tief und 10 bis 15 Meter im Durchmesser. Einige kann man heute noch trotz des Bewuchses im Hohen Hain finden.
Beschädigt wurden in Limbach 70 Gebäude, eins davon total, drei schwer, die Schäden an Fenstern und Dächern sowie an den Gleisanlangen am Bahnhof waren bedeutend. Die Stadtverwaltung Limbach leitete Sofortmaßnehmen ein zur Unterbringung der Obdachlosen, zur Wiederherstellung der Strom-, Gas- und Wasserversorgung und stellte nach dem Angriff fest, dass 299 Sprengbomben, je 125 Kilogramm schwer und 24 Phosphor-Brandbomben (je 56 Kilogramm) abgeworfen worden waren. Auch in den Nachbargemeinden – Niederfrohna, Kändler, Rabenstein, ferner in Chemnitz - waren im gleichen Zusammenhang Bombenschäden zu verzeichnen. 1945 nahmen die Luftangriffe und Überflüge zu und damit die Zahl der Fliegeralarme. Paul Fritzsching zählte im Januar siebenmal Alarm in Limbach und Oberfrohna, im Februar 16 Alarme, im März 22 und im April bis zum 14.4. neunmal Fliegeralarm.
Am Dienstag, dem 6. Februar 1945 wurde von 11.15 bis 12.30 Uhr Fliegeralarm ausgelöst. Eine Staffel anglo-amerikanischer Flugzeuge bombardierte Oberfrohna. Getroffen wurde der Bahnhof und besonders der Ortsteil westlich vom Jahnhaus - Sportplatz, Siedlerweg, Rußdorfer Straße, Rosenhof. Hier wurden nach dem Angriff 85 Bombentrichter gezählt. Bei dem Bombardement kamen 15 Menschen ums Leben, alles Zivilisten, davon sieben Frauen und zwei Kinder. Ihre Gräber sind auf dem Oberfrohnaer Friedhof noch zu sehen. Die Zahl der Verletzten ist unbekannt.
Es wurden 30 Häuser teils völlig, einige teilweise zerstört. Ein Foto der getroffenen Häuser am Rosenhof ist erhalten. (Foto) Das Haus Siedlerweg 8 sank in Trümmer und begrub zwei Menschen unter sich, ein anderes wurde schwer getroffen. Bedeutende Schäden erlitten Häuser an der Wolkenburger Straße, dort brannte die Trikotagenfabrik Haustein (Nummer 15) nieder, der Besitzer kam um.
Am Bahnhof entstanden Bombenschäden. Schienen wurden aufgerissen, Waggons zertrümmert, Bahngebäude stark beschädigt. Schäden am Wasserwerk stellten die Wasserversorgung zeitweise in Frage. Außerdem richteten die Bomben Schäden auf dem Friedhof an, wo Gräber verwüstet wurden.
Im April 1945 griffen noch amerikanische Tiefflieger mit Bordwaffen an. Dabei kam es in Limbach zu Schäden, ein Kind wurde getötet, der Enkel des Parkschänkenwirts Arno Harzendorf. Der Einmarsch der Amerikaner nach Artilleriebeschuss und einzelne Kampfhandlungen forderten in Oberfrohna und Rußdorf noch am 14. April zehn Todesopfer. Aber mit dem Einmarsch der US-Armee waren sechs Kriegsjahre mit entsetzlichen Schäden und schrecklichen Opfern vorbei.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 12. Mai 2016 -
Rußdorfer Heimatgeschichten von Hans Lange
Rußdorfer Heimatgeschichten von Hans Lange
Beide Texte aus: Hans Lange „Ein Rußdorfer Heimatbild“ (leicht gekürzt)
Sehr geehrte Leserinnen und Leser des „Stadtspiegel“,
in den neunziger Jahren veröffentlichte Hans Lange (1922-2008) zwei Hefte unter den Titeln: „Ein Rußdorfer Heimatbild“ und „Rußdorfer Allerlei“
Hans Lange war ein Rußdorfer Neulehrer. Von 1946 bis Ende der 1950er Jahre war er Lehrer in der Schule in Rußdorf. Danach, bis zu seinem Ruhestand arbeitete er als Lehrer in der Geschwister-Scholl-Schule in Limbach.
In seinem Vorwort im „Rußdorfer Heimatbild“ schreibt Hans Lange:
Als alter Rußdorfer interessiere ich mich natürlich ganz besonders für mein ehemaliges Heimatdorf. So sammelte ich Unterlagen in alten Schriften und Zeitungen, wühlte in Chroniken, las die Geschichten der ehemaligen Vereine, blätterte im Kirchenbuch und sprach mit den ältesten Einwohnern, um so viel wie möglich zu erfahren. Einiges schrieb ich auch auf, was in meiner Familie und bei den Nachbarsleuten geschah und erzählt wurde. Weil ich das so erworbene Wissen nicht für mich behalten wollte, entstand nach und nach dieses Heft, von dem manches schon in verschiedenen Zeitungen gedruckt wurde. Wenn ich den Rußdorfern mit diesem Heft eine Freude bereite, dann hat es voll und ganz seinen Sinn und Zweck erfüllt.
Rußdorf im Jahre 1997
Im Schlusswort des 2. Heftes schreibt Hans Lange:
Es gibt sehr viel über Rußdorf zu berichten. Ich stellte das Heft so zusammen, dass es den Wünschen mancher Leser entspricht. Man könnte noch umfangreicher berichten. Ich glaube für jeden Geschmack etwas gebracht zu haben. Möge das Geschriebene gut ankommen.
Das wünscht Hans Lange
Viele dieser Berichte, Zahlen und Geschichten sind so interessant, dass sie vielleicht auch für manchen Bräunsdorfer, Kändleraner, Kaufunger, Limbacher, Oberfrohnaer, Pleißaer und Wolkenburger Bürger lesenswert sein könnten. Hans Lange stellt auch so manche, der Rußdorfer Originale vor. Es ist einfach köstlich und amüsant, diese einmaligen Personen kennen zu lernen. Seien Sie gespannt auf die zukünftig im „Stadtspiegel“ veröffentlichen Auszüge aus diesen beiden Heften.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen, als ehemaliger Rußdorfer
Manfred Keller
Die Rußdorfer Zollstation
Mitten in Rußdorf, jetzt Limbach-Oberfrohna, Waldenburger Straße 135, befindet sich ein Altbau, heute ziemlich abgewirtschaftet, einst Stelzmanns Restaurant. (Anmerkung der Redaktion: Heute steht an der Stelle der Neubau Autohaus Schmidt und ein Schlagbaum erinnert an die ehemalige Zollstation an der Stelle.) Wenn der Herzog von Altenburg in längst vergangenen Zeiten seine Enklave Rußdorf, mitten im Sachsenland gelegen, besuchte, stieg er meist bei Stelzmanns ab, um einen Begrüßungstrunk zu sich zu nehmen. Die Rußdorfer jubelten ihm dann zu, meist war an diesem Tag schulfrei. Das ist Rußdorfer Geschichte.
Dass der Herzog gerade bei Stelzmanns abstieg, hatte natürlich seinen Grund. Hier war nämlich die Zolleinnahme. Alle Fremden, die mit ihrem Fuhrwerk durch Rußdorf fuhren, mussten hier ihr Scherflein, wenn es auch nur wenige Pfennige waren, entrichten. Das östlichste Fenster im Erdgeschoss war deshalb zum Schieben eingerichtet. Es wurde ein löffelartiger Holzgegenstand herausgestreckt und so der Zoll kassiert. Die Einnahmen mögen recht mager gewesen sein. Jedenfalls wurde nach dem ersten Weltkrieg auf diesen Zoll verzichtet.
Am 2. April 1928, 20 Uhr fand bei Stelzmanns eine wichtige öffentliche Gemeinderatssitzung statt, auf der die Übernahme der Gemeinde Rußdorf durch den Verband des Freistaates Sachsen getätigt wurde. Neben dem Gemeinderat waren dazu der Landrat von Altenburg und der Kreishauptmann von Chemnitz anwesend. Durch den Staatsvertrag vom 7. Dezember 1927 wurde Rußdorf an den Freistaat Sachsen abgetreten. Dabei wurde Rußdorf als ein ruhiger Ort mit guter Industrie dargestellt (Anmerkung der Redaktion: siehe auch Überblick im Anschluss). Weiter wurde erklärt, dass die Abtretung durch einen Gebietsaustausch ermöglicht wurde. Der Gegenwert war die Gemeinde Liebschwitz und Umgebung. Aus verwaltungstechnischen Gründen kam schließlich der Austausch auf Antrag des Gemeinderats zustande. So wurden aus den Thüringer Rußdorfern über Nacht Sachsen. Rußdorf war am 15. Januar 1457 durch die Schuldenwirtschaft eines Ritters von Einsiedel an das Domkapitel des Georgenstifts Altenburg übereignet worden. In der Folgezeit wurden in Rußdorf sogenannte Lehengerichte abgehalten, in denen alles geklärt wurde. Sogar Todesstrafen konnten gefällt und vollstreckt werden. Durch die spätere Industrialisierung brachte die weitentfernte Kreisstadt Altenburg viele Erschwernisse mit sich. Wenn beispielsweise in der Inflationszeit das Geld aus Altenburg erst verspätet eintraf, war es nichts mehr wert.
Ein Herr Trinks betonte bei der Übergabe, dass für die Arbeiterschaft weder etwas gewonnen noch verloren würde. Sinnvoll sei es, mit den Nachbargemeinden besser zusammenzuarbeiten und vielleicht zur Bildung einer Großgemeinde zu kommen. Wenn man so will, könnte man dieses Wort, 1928 gesprochen, als Basis für den späteren Zusammenschluss Limbach – Oberfrohna – Rußdorf nehmen, der am 1. Juli 1950 vollzogen wurde. Da hat erwähnter Herr Trinks auch mitgewirkt.
In den 1930er Jahren gab es in Rußdorf:
46 landwirtschaftliche Betriebe, 8 Handschuhfabriken, 4 Strumpffabriken, 5 Maschinenfabriken, 13 Trikotagenfabriken, 5 Spulereien, 3 Nadelrichter, 2 Schlossereien, 10 Bäckereien, 7 Fleischereien, 4 Hausschlächter, 15 Gastwirtschaften, 26 Lebensmittelgeschäfte, 6 Friseure, 5 Maler, 17 Schneider, 10 Schuhmacher, 7 Tischler, 3 Sattler, 2 Schmiede, 10 Schnittwarengeschäfte, 4 Klempner, 1 Bürstenmacher, 1 Brunnenbauer, 1 Senffabrik, 3 Radiogeschäfte, Ärzte, Zahnärzte, Apotheke, Glasmaler, Geigenvirtuosen, Kunstmaler, Puppenspieler, viel ambulantes Gewerbe und und und.
Rußdorf hatte damals etwa 4.000 Einwohner.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 14. April 2016 -
Die Firma Hermann Dittrich – Oberfrohna in Sachsen
Die Firma Hermann Dittrich – Oberfrohna in Sachsen
Marvin Müller
Hermann Dittrich, so hieß die ehemalige Weltfirma auf der Hauptstraße 2 (heute Fronbachstraße 2) in Oberfrohna. Mit ihrem Kürzel „Hedi“ eroberten sie den Weltmarkt für Handschuhe. Hedi, das stand für Qualität und Wertarbeit! Die Firma trug neben vielen anderen zum einstigen Ruhm von Oberfrohna bei. So unterstützte sie zum Beispiel den Bau des Jahnhauses und stiftete eines der fünf Fenster für die Aula der Gerhart-Hauptmann-Schule.
Gegründet wurde die baldige Weltfirma am 1. April 1855. Die Firmengründer Hermann Dittrich und Laura Dittrich geb. Gränz erwarben für 100 Heiratstaler zwei Handwirkstühle um den Handschuhstoff herstellen zu können. Untergebracht wurden diese in den Anfangsjahren in bescheidenen Räumen im alten Gut Gränz. Schon bald wurden die Handschuhe weit über die Grenzen der Heimat hinaus bekannt. Nun wurden die Räumlichkeiten im alten Gut bald zu bescheiden, also erwarb der „alte Hermann“ ein eigenes Grundstück. Dies diente als Wohn- und Fabrikationsgebäude. Am 22. Juli 1887 übergab Hermann Dittrich das noch junge Unternehmen an seine drei Söhne Robert, Karl und Ernst. Diese verstanden es, das Unternehmen voran zu bringen, und so konnte der Gebäudekomplex mehrfach erweitert werden. Schon 1891 konnte man eine moderne Kesselanlage mit Dampfmaschine erwerben. Selbstverständlich wurde auch der Maschinenpark immer auf den neusten Stand gebracht.
Nach dem Tod von Karl Dittrich trat der Sohn von Robert Dittrich in das Unternehmen ein. Otto Dittrich konnte viele Erfahrungen aus London und Paris mitbringen. Ihm ist es zu verdanken, dass die Firma Hermann Dittrich ihre Exportverbindungen bald erweitern konnte. Wegen einer Krankheit seines Vaters musste er bald den gesamten Betrieb übernehmen. Unterstützt wurde er bei dieser schweren Arbeit von seinem Bruder Max Dittrich. Mit dem Einsatz des Doppelstuhles wuchsen die Exportverbindungen weiter an, somit musste auch das Betriebsgebäude erweitert werden. Nach dem ersten Weltkrieg kam der Betrieb kurzzeitig zum Erliegen, denn es mangelte an Rohstoffen und Absatz für die Handschuhe. Auch die Inflationsjahre brachten viele Schwierigkeiten mit sich. Man versuchte vergebens die alten umfangreichen Exportverbindungen wieder aufzubauen. Nun gab es aber noch die bevorzugte kunstseidene Damenwäsche. Die Fabrikanten beschlossen, diese in die Produktion aufzunehmen. Diese Abteilung wurde bald die größte im gesamten Betrieb. Es erfolgten weitere Ergänzungen der Fabrikation durch Blusen und Wirkstoffe für Trikotagen. 1924 erwarb die Firma Hermann Dittrich ein naheliegendes Gebäude. 1939 erfolgte ein weiterer Anbau des Fabrikationsgebäudes. Es entstanden: ein Luftschutzbunker, ein Eingangstor mit zwei Figuren des Bildhauers Heinrich Brenner aus Chemnitz. Die linke Figur zeigt einen männlichen Zuschneider und die rechte eine stoffabrollende Frau. Über ihr, stand einst der Schriftzug „Hedi“. Außerdem entstanden drei erweiterte Fabrikationsräume und ein Festsaal mit Bühne direkt unter dem Dach.
Der zweite Weltkrieg führte zur Beschränkung der Fabrikationsmöglichkeiten. Durch die verlorengegangenen Exportverbindungen kam die Stoffhandschuhherstellung fast völlig zum Erliegen. Die Herstellung von Damenwäsche und Blusen konnte im geringeren Maße aufrechterhalten werden. 1944 stand der Betrieb sogar kurzzeitig ganz still. Doch 1945 konnte die Produktion wieder fortgesetzt werden. 1950 wurde die Leitung des Betriebes Gerhard Kuhn in die Hände gelegt. Gleichzeitig wurde Hans Hermann Dittrich, der Sohn von Max Dittrich, Leiter der Abteilung für Stoffherstellung. Durch die Leipziger Mustermesse gelang dem Betrieb die Wiederherstellung von Exportverbindungen. Diese neuen Verbindungen waren natürlich viel geringer als die beispielsweise vor dem zweiten Weltkrieg. Anfang 1954 verstarb Max Dittrich. Trotz seiner schweren Krankheit war er bis zum letzten Tag im Betrieb tätig. Ab 1954 wurde der Betrieb zur Hermann Dittrich KG.
1972 wurde der Betrieb zwangsverstaatlicht und nannte sich ab jetzt VEB Wirkmode, Werk 1. Mit der Zwangsverstaatlichung wurde auch der bildschöne Schriftzug „Hedi“ über dem Eingangstor der Firma Hermann Dittrich zerstört. Er wurde durch ein primitives Plastikschild ersetzt.
1989 wurde der VEB Betrieb in eine GmbH umgewandelt. Ab jetzt wurde unter dem Namen „Hedi Maschenmode GmbH“ produziert. Das Ganze ging bis 1995. Der ehemalige Chef dieser GmbH, Herr Baier, sagte: „Wir haben einfach aufgehört zu produzieren, denn der Absatz wurde immer geringer.“ Somit schloss Hermann Dittrich 1995 nach 140 Jahren endgültig seine Pforten.
Liebe Leserinnen und Leser,
Zur weiteren Erforschung der Firmengeschichte von Hermann Dittrich suchen wir weitere Unterlagen, Fotos und so weiter. Wenn Sie etwas derartiges besitzen, melden Sie sich bitte beim Förderverein Esche-Museum e.V.
Marvin Müller
Marvin Müller, 15 Jahre alt, ist das jüngste Mitglied des Fördervereins Esche-Museum e.V. Wir freuen uns sehr, dass er sich so engagiert und aktiv mit der Geschichte unserer Stadt
auseinandersetzt. Die vorliegende Firmengeschichte ist seine erste selbständige Arbeit auf diesem Gebiet.
Förderverein Esche-Museum e.V.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 17. März 2016 -
Bruno Granz (1880 -1937) - ein Limbacher Kommunistenführer
Bruno Granz (1880 -1937) - ein Limbacher Kommunistenführer
Dr. H. Schnurrbusch - aus dem Heft „Personen und Persönlichkeiten“ © 2006,2016
Die Hefte zur Heimatgeschichte vertreibt die Buchhandlung am Johannisplatz 3.
„Der Kommunismus war die einzige Bewegung der jüngeren Geschichte, die mehr ihrer eigenen Führer, Funktionäre und Mitglieder selbst umgebracht hat, als das ihre Feinde taten.“ (Hermann Weber)
Bruno Granz spielte als Vorsitzender der Limbacher KPD, als Stadtverordneter und als Mitglied des Sächsischen Landtages in der politischen Landschaft von Limbach und der umgebenden Region zwischen 1910 und 1933 eine bedeutende Rolle.
Geboren ist er am 6. Dezember 1880 in Callenberg bei Waldenburg. Er lernte Bäcker und trat im Jahre 1900 dem Verband der Bäcker Deutschlands bei. In den Jahren 1902 und 1903 arbeitete er in England und kam dort als Mitglied des „Communistischen Arbeiterbildungsvereins“ in Kontakt mit den Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels. Beide kommunistischen Gründerväter hatten noch einige Jahre zuvor in London gelebt, Marx bis 1870, Engels bis 1895. Ihre sozialkritischen und materialistisch-philosophischen Schriften begründeten die Theorie des sogenannten „wissenschaftlichen Sozialismus“, der den Zusammenbruch des Kapitalismus prophezeite und über die Phase einer Diktatur des Proletariats den Übergang zu einer weltweit klassen-, staaten- und geldlosen Gesellschaft als gesetzmäßige Entwicklung verkündigte. Das waren nun die Ziele, deren Bewerkstelligung sich der junge Granz als Lebensinhalt auf die rote Fahne schrieb.
Nach Deutschland zurückgekehrt, trat er 1906 der Sozialdemokratischen Partei August Bebels bei und wohnte zunächst als Fabrikarbeiter in Chemnitz. Nach Limbach kam er 1910, die Konsumgesellschaft hatte ihn als Backmeister gewählt. Die „Limbacher-Aktien-Konsum-Gesellschaft“ war im Gasthaus „Stadt Wien“ am 23.10.1887 anstelle eines älteren „Allgemeinen Konsumvereins“ von 1862 gegründet worden. „Der Konsum“, wie er in Limbach hieß, hatte 1908 eine Bäckerei (Moritzstraße 15) errichten lassen. Die Aktiengesellschaft wurde 1918 zur Genossenschaft und verstand sich als Kampforganisation „zur Befreiung der Arbeiterklasse von kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung“. Hier begann Granz eine Tätigkeit, die dem Raum Limbach den Ruf einer „Hochburg der Roten“ in Sachsen eintrug. Er fühlte sich zum Revolutionär berufen.
Zu einer Bezirksversammlung der SPD am 10. Februar 1915 in Chemnitz befanden sich Granz und das damalige Limbacher SPD-Vorstandsmitglied Gustav Semmler in lebhafter Opposition zur Meinung des SPD-Parteiblattes „Volksstimme“. Dies hatte die Zustimmung der SPD-Reichstagsfraktion zu den Kriegskrediten (mit der Gegenstimme Karl Liebknechts) im Reichstag am 4.8.1914 gut geheißen. Hier kündigt sich schon die Spaltung in der SPD an, mit der sich später die Kriegsgegner zum Spartakusbund und zur USPD formierten.
Folgerichtig gehörte Bruno Granz 1917 zu den Aktivisten der Spartakusgruppe im Raum Limbach, er gründete mit Valeska Meinig und Gustav Semmler die USPD und wurde ihr Vorsitzender. In dieser Eigenschaft arbeitete er mit Fritz Heckert zusammen, dem Leiter der Spartakusgruppe in Chemnitz. Fritz Heckert (1884-1936), Mitbegründer des Spartakusbundes und der KPD, 1920 Mitglied des ZK der KPD, Stalinist im Führungskreis Thälmanns, starb 1936 in Moskau (vor den „Säuberungen“). Das Jahr 1918 brachte mit dem Ende des Weltkrieges auch die Novemberrevolution. Am 12. November „fand die öffentliche Verkündung der revolutionären Neuordnung in Staat und Gemeinde“ statt (Allgemeiner Anzeiger Oberfrohna). Eine Demonstration zog vom Hotel „Johannesbad“ zum Ludwigsplatz, dort wurden die Namen des Arbeiter- und Soldatenrates bekannt gegeben, „dem alle öffentlichen und behördlichen Institutionen unterstehen“. als Vorsitzende Bruno Granz und Ewald Glombitza (Kändler), zu weiteren Mitgliedern gehörte Valeska Meinig. Der Arbeiter- und Soldatenrat (Büro Moritzstraße 15) setzte die Amtsenthebung der unbesoldeten Stadträte durch und übte bis zum 15. Dezember die Polizeigewalt aus. Limbach wurde zur Garnison erklärt und Granz zum Garnisonsältesten. Sein Befehl Nr. 1 verbot das Tragen militärischer Abzeichen und den Handel mit militärischen Ausrüstungen.
Bei der Limbacher Stadtverordnetenwahl am 10. Februar 1919 erhielt die USPD 10 Sitze, die „Bürgerlichen“ 9 und die (Mehrheits-) SPD 8 Mandate. Bruno Granz wurde als Stadtverordneter (bis 1933) gewählt und zum ersten Mal in Limbach auch eine Frau, Granzens Freundin Valeska Meinig. Im März 1919 gründete sich aus der USPD eine KPD-Ortsgruppe (Granz, Meinig). 1920 wurde bei dem sog. Kapp-Putsch am 13. März der Generalstreik ausgerufen und ein Aktionsausschuss (Granz, Meinig, Heim u.a.) „übernahm die politische Macht“. Bewaffnete Arbeiter besetzten alle öffentlichen Gebäude und übten zwei Tage lang die Polizeigewalt aus. Der Putsch brach bald zusammen. Im Jahre 1920 ließ die Stadt Limbach auch Notgeld drucken, auf den 20-Mark-Gutscheinen unterschrieben der Bürgermeister Dr. Kretzschmar und für den „Vollzugsrat“ Bruno Granz, weswegen die Scheine im Volksmund auch „Granzgeld“ oder „Kommunistengeld“ hießen. 1922 bis 1923 vertrat Granz die KPD im Sächsischen Landtag. Als 1923 die Reichswehr Limbach besetzte und Kommunisten wie Sozialdemokraten im Hotel „Hirsch“ verhörte, misshandelte und einsperrte, wurde auch das Konsum-Gebäude durchsucht und nach Granz und Genossen gefahndet. Der war aber untergetaucht und konnte nicht gefasst werden.
1928 besuchte Granz mit einer Genossenschaftsdelegation die Sowjetunion. Seine Eindrücke vom Paradies der Werktätigen schrieb er in einer Broschüre nieder, in der u.a. steht. „Es geht vorwärts und aufwärts zu wahrer menschlicher Gemeinschaft in der Sowjetunion.“ Unter der Leitung von Granz wurde aus dem Konsumverein ein „Zentrum des Klassenkampfes“ der KPD. 1932 heißt es in einem Aufruf an die Genossenschaftsmitglieder: „Für ein freies sozialistisches Rätedeutschland im Bündnis mit der Sowjetunion und dem Weltproletariat“ (Mitteilungsblatt der Konsum-, Produktiv- und Spargenossenschaft für Limbach und Umgegend e.G.m.b.H. März 1932, Nr. 1.) Granz forderte am 20.11.1932: „Die Hauptaufgabe der Konsumgenossenschaften muss sein, den revolutionären Befreiungskampf ... zu unterstützen und sich in den Gesamtkampf des Proletariats zur Überwindung des Kapitalismus einzugliedern ...“
Das Hauptgebäude des „Konsum“ wurde so als Sitz der Limbacher KPD auch Hauptquartier bei den Straßenkämpfen mit den Nationalsozialisten. Schon 1929 fand die Polizei Waffen und Munition in dem Gebäude und später „eignete es sich vorzüglich, Vorstöße über den Johannisplatz in die Helenenstraße zum Sitz der Nazis im ‚Deutschen Haus‘ (Nr. 19) zu unternehmen. Vom Konsumvereinsgebäude aus erfolgten die Kämpfe um die Eroberung der Straße...“ (R. Weber). Politische Auseinandersetzungen wurden nun mit Schlagstock, Messer und Revolver ausgetragen. Dementsprechend schlugen Kommunisten und Nazis sich wechselseitig die Köpfe blutig und die Fensterscheiben im „Deutschen Haus“ und im Konsumgebäude ein. Die „Eroberung der Straße“ forderte viele Verletzte, sogar Tote auf beiden Seiten, nicht nur Rudolf Marek oder Herbert Grobe. Durch seine Tätigkeit in der KPD, im Rot-Front-Kämpferbund, in der Roten Gewerkschaft, durch seine vielen öffentlichen Auftritte und seine Rolle in Straßenkämpfen wurde Granz als „Kommunistenhäuptling“ bald zum Feind Nummer Eins der Limbacher Nazis.
1933 emigrierte er in die Tschechoslowakei, von dort 1934 in die Sowjetunion, wohin 1927 sein Sohn Kurt ausgewandert war, der 1937 vom NKWD verhaftet und am 28.2.1938 erschossen wurde. Seinen anderen Sohn Herbert ermordeten die Nazis am 9. März 1933. Bruno Granz wurde am 3.11.1937 in Butowo vom NKWD im Zuge Stalinscher Säuberungen erschossen, in der 1936 bis 1938 nicht nur über eine Million sowjetischer und ausländischer Kommunisten ermordet wurden, sondern darüber hinaus breite Schichten der eigenen Bevölkerung. Von den 43 Mitgliedern und Kandidaten, die dem 1920 geschaffenen Politbüro (Polbüro) der KPD zwischen 1920 und 1933 angehörten, fielen mehr Personen den Stalinschen Mordaktionen zum Opfer als dem Terror Hitlers.
Granz suchte Schutz vor dem Naziterror und wurde Opfer seines bornierten Glaubens an eine verbrecherische Heilslehre, an einen Kommunismus, der, zur Staatsmacht geworden, Terror ausübte gegen das eigene Volk, mörderisch gegen ganze Klassen von Bourgeois, Kulaken usw., aber auch gegen die eigenen Funktionäre, die als Abweichler, Trotzkisten und Volksfeinde zu Tausenden vom NKWD (Vorbild der Stasi) erschossen wurden.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 3. März 2016 -
Die „Leipziger Baumwollweberei Wolkenburg“, von 1943 bis 1945 eine Außenstelle des KZ Flossenbürg
Die „Leipziger Baumwollweberei Wolkenburg“,
von 1943 bis 1945 eine Außenstelle des KZ Flossenbürg
Rolf Kirchner
Der Betrieb, der ab 1795 zunächst als Schafwollmaschinenspinnerei gegründet worden war, wurde im Jahre 1886 in eine Weberei umstrukturiert. Im Jahre 1963 erfolgte eine Umstellung auf die neue Malimo-Nähwirktechnik.
Auf Regierungsbeschluss vom 9. September 1943 musste die Baumwollweberei ihre Produktion einstellen. Der Betrieb wurde dem Reichsluftfahrtministerium unterstellt. Bis zum 13. April 1945 produzierte dort die Firma Opta Radio AG Leipzig kriegswichtige Teile für die Luftrüstung. Der Betrieb war 1923 von den Gebrüdern Sigmund und David Ludwig Loewe als „Radio Frequenz GmbH“ gegründet worden. Im Jahre 1933 emigrierten die Brüder Loewe aus Deutschland, da sie als Juden befürchten mussten inhaftiert und in ein KZ gebracht zu werden. Infolge der näher rückenden Front und der immer häufiger werdenden Luftangriffe verlagerte man die Produktion aus dem schlesischen Goldberg nach Wolkenburg, Wüstenbrand und Oberlungwitz. Als Arbeitskräfte verschaffte sich der Betrieb KZ-Häftlinge aus den KZ Flossenbürg, Bergen-Belsen, Ravensbrück und Auschwitz. Die ersten Häftlinge kamen per Eisenbahnwaggons an, später auch mit LKW. Die Fachleute der Opta wohnten in eiligst am Siedlerweg errichteten Barracken. Am oberen Teil des Weberberges errichtete man einen betonierten Luftschutzkeller. Die Arbeiterinnen, es waren ausnahmslos Frauen, arbeiteten und schliefen im Betrieb. Bei Luftangriffen fanden sie Schutz in einem unterirdischen Gang unter den Shedsaal der Weberei. Auch etwa 30 Frauen aus Wolkenburg arbeiteten im Rüstungsbetrieb. Zwischen jeweils zehn KZ-Häftlingen saß eine deutsche Frau, damit bei Störungen der Reparaturdienst gerufen werden konnte. Leiter des Betriebes war der SS-Oberschaarführer Wilhelm Brusch, für die Bewachung waren noch etwa 24 Aufseherinnen der SS tätig. Die Häftlinge arbeiteten gemeinsam mit den deutschen an einem „Fließband“ wie einer der Wolkenburger Frauen bei einem Interview mitteilte. Produziert wurden Teile für die Luftrüstung wie „Abhörgeräte“.
Die KZ-Häftlinge kamen aus neun Ländern. Sie kamen oft vollkommen entkräftet in Wolkenburg an, so dass insgesamt sieben Häftlinge während dieser Zeit starben: Johanna Anton, Ursula Bruschinsky, Wladislawa Prydzielsko, Jerowesa Warschinska, Erna Kreutz, Alma Morgenstern.
Am Morgen des 13. April, einem Freitag kurz vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen in Wolkenburg wurde der Betrieb geräumt und die Häftlinge traten ihren Marsch in Richtung KZ-Dachau an. Es waren fast 400 Häftlinge. Wolkenburger Bürger, die diesen Abmarsch beobachteten, waren erstaunt über die große Anzahl der Häftlinge. Viele der Frauen starben auf diesem Marsch oder sollen erschossen worden sein.
Am 9. November 2000 wurde vor dem Gelände der ehemaligen Weberei ein Gedenkstein enthüllt, der an eines der düstersten Kapitel der deutschen Geschichte erinnern soll. Dass Gewalt kein Mittel ist, Konflikte zu bewältigen, daran erinnerten aus Anlass der Enthüllung dieses Gedenksteines der damalige Oberbürgermeister von Limbach-Oberfrohna, Dr. Hans-Christian Rickauer, sowie der Wolkenburger Pfarrer Cornelius Epperlein.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 18. Februar 2016 -
Ein Beitrag zum „Auszug der Achthundert“ vor 176 Jahren
Ein Beitrag zum „Auszug der Achthundert“ vor 176 Jahren
Hartmut Reinsberg
In den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts gab es in unserer Region unter den evangelischen Christen große Differenzen in der Auslegung des Glaubens. Die offizielle Landeskirche war für eine liberalere Auslegung, was bei den bibelfesten Anhängern auf heftige Kritik stieß, so dass diese sich an den Dresdener Pfarrer Stefan orientierten, welcher eine Auswanderung nach Amerika plante. Man war der Auffassung, dass man in Amerika frei seinen Glauben ausüben könne. Die Schriftstellerin Ingerose Paust hat diese Geschehnisse literarisch aufgearbeitet und darüber einen historischen Roman „Auszug der Achthundert“ geschrieben. 1838/39 war es dann soweit, dass an die 800 Christen aus Sachsen unter Führung von Pfarrer Stefan von Bremerhaven aus mit fünf Segelschiffen die Überfahrt in die Südstaaten von Amerika wagten. Unter den Ausreisenden waren auch viele Familien aus Niederfrohna, Bräunsdorf und Langenchursdorf. Darunter war auch der aus Langenchursdorf stammende Bräunsdorfer Pfarrer Carl Ferdinand Wilhelm Walther. Pfarrer Walther fuhr mit dem Auswanderer-Schiff „Olbers“ bis in den Hafen von New Orleans und von dort dann weiter mit einem Flußschiff entlang des Mississippi bis in die Nähe von St. Louis in den Staat Missouri. Dort gründeten sie ihren „Gottesstaat“, wo sie niemand mehr wegen ihres Glaubens verfolgen konnte. Der Anfang war äußerst schwierig und forderte viele Opfer. Dazu kam, dass der Pfarrer Stefan die gemeinsame Kasse veruntreut hatte und verstoßen wurde. Nun übernahm der Pfarrer Walther die Verantwortung für die Auswanderer und gründete die noch heute bestehende Evangelische Missouri-Synode. Eine besondere Würdigung erfuhr er, indem man ihn als den Luther von Amerika bezeichnete.
Neben der Schriftstellerin Frau Paust haben noch einige Familien aus Niederfrohna und Rußdorf Kontakte mit den Nachfahren in den USA. Diese Kontakte werden durch gegenseitige Besuche wieder gepflegt und zu den Ortsjubiläen von Langenchursdorf und Niederfrohna kamen z B. Nachfahren der Aussiedler. Zum 6. Feldtag in Rußdorf teilte mir auch Herr Hecht mit, dass er erst kürzlich seine Vorfahren besucht habe. Auch nach Bräunsdorf kam 1993 ein vollbesetzter Reisebus mit Nachfahren, welche von unserer Kirchgemeinde unter Regie von Pfarrer Leonhardi mit Hingabe betreut wurde. Bei dieser Reisegruppe war auch ein Nachkomme von unserem ehemaligen Pfarrer C.F.W. Walther, Reverend Walther, dabei. Unsere Gäste haben sich vor allem im Kirchenarchiv für ihre Vorfahren interessiert. Nach der Suche von Sponsoren für unsere Evangelische Grundschule hatte ich mich auch an die heutigen Vertreter der Missouri-Synode gewandt, welche auf mein Ersuchen leider nicht reagierten. Ich selbst wollte vor ca. 20 Jahren mit dem damaligen Pfarrer Jung aus Niederfrohna mit mehreren Interessenten nach Amerika reisen. Leider zogen mehrere Teilnehmer ihre Reisezusage zurück, so dass wir die Reise absagen mussten. Besonders schön fand ich, dass zu den Ortsjubiläen von Langenchursdorf und Niederfrohna mehrere Nachfahren auf einer Nachbildung eines Auswanderer-Schiffes in historischen Kostümen dem Auszug der 800 dargestellt haben. Auch zu unserer 725 Jahr Feier gestaltete unsere Kirchgemeinde ein Bild mit dem Auszug der Achthundert. Der ehemalige Bürgermeister von Langenchursdorf Jürgen Lindner stellte uns sein Schiffsmodell zur Verfügung und wir konnten das Modell nach einen Umbau auf Pferdebespannung im Festumzug mitführen.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 21. Januar 2016 -
Begründer der schweizerischen Trikotagenindustrie - ein Limbacher Handwirker
Begründer der schweizerischen Trikotagenindustrie - ein Limbacher Handwirker
Joseph Sallmann
In den 1990er Jahren besuchte mich Robert Sallmann aus der Schweiz. Herr Sallmann war bis 1990 Geschäftsführer der Sallmann AG aus Amriswil und recherchierte jetzt als Ruheständler über den Firmengründer Joseph Sallmann, welcher aus Limbach stammte und 1849 emigrieren musste. Robert Sallmann ist im Besitz von Dokumenten sowie eines Tagebuchs von Joseph Sallmann aus der Zeit seiner Flucht. Er hat ein Buch verfasst mit dem Titel: „Joseph Sallmann, Begründer der schweizerischen Trikotindustrie“. Dieses beeindruckende Dokument der Zeit- und Industriegeschichte be-sticht besonders durch die vielen Zitate aus Originalen jener Zeit und ist nicht nur ein interessantes Dokument hinsichtlich der chro-nologischen Entwicklung der Firma Sallmann AG, sondern darüber hinaus auch bezüglich der politischen Verhältnisse in Sachsen um 1848/49 und nicht zuletzt ein informatives Kapitel der Limbacher Heimat- und Industriegeschichte. Joseph Sallmann wurde 1823 in Limbach, im damaligen Oberkänd-ler, geboren. Sein Vater Johann, ein angesehener Strumpfwirker, hat-te ein eigenes Strumpffaktorengeschäft. Bereits 1807 besaß dieser 18 Strumpfwirkstühle. Das Elternhaus war das alte Fachwerkhäuschen, das sich an der Ecke Chemnitzer Straße und Bernhardstraße befand. Auch die spätere Fabrik, die Johann Sallmann ab 1849 mit Wohn- und Geschäftshaus auf der gegenüberliegenden Seite errichtete, steht noch jetzt an der Kreuzung Chemnitzer Straße und Ostring. Es handelt sich hierbei um einen für unsere Gegend typischen Bau aus der Zeit des Übergangs von der Faktorei zur Fabrik.Joseph erlernte zu Hause den Beruf als Strumpfwirker. Als politisch interessierter Mensch engagierte er sich im Gemeinderat und in den Vaterlandsvereinen. In den Jahren 1848/49 herrschte auch in den Limbacher bürgerlichen Kreisen eine große Unzufriedenheit mit der Obrigkeit, und man wollte eine Veränderung zu mehr bürgerlichen Freiheiten erzwingen. Da der sächsische König Friedrich August II. die Reichsverfassung des Frankfurter Parlaments von 1849 nicht anerkannte und nach seiner Flucht auf die Burg Königstein sogar preußische Truppen zur Niederschlagung des Volksaufstandes an-forderte, steigerte sich die Erregung des Volkes noch weiter. Auch in Limbach hieß es: „Das Vaterland ist in Gefahr! Wir müssen nach Dresden und die Rechte des Volkes auf den Barrikaden verteidi-gen!“. Jetzt stellte sich Joseph Sallmann, der bereits Mitglied des „Comite zur Sammlung für Waffen und Geld für die Freischärler“ war, an die Spitze von Freischärlern aus Limbach, es sollen mehr als 40 gewesen sein, und zog mit ihnen nach Dresden. Das säch-sische Militär hatte aber bald mit preußischer Unterstützung den Aufstand niedergeschlagen. Nun setzte eine wütende Verfolgung der Anführer des „Zuzugs“ nach Dresden ein. Joseph emigrierte in die Schweiz. Nach mehreren vergeblichen Bemühungen, eine Amnestie zu erreichen um in die Heimat zu seiner Frau und seinen vier Kindern zurückzukehren, gelang es ihm in der Schweiz, eine neue Existenz als Strumpfwirker aufzubauen. Im Juni 1850 ließ er seine Familie nachkommen. Die Trennung von seiner Familie und die Ungewissheit der Zukunft waren für Joseph und auch seine Frau eine bittere Zeit. Davon zeugen die zu Herzen gehenden Tag-buchnotizen und Briefe. Man kann daraus ersehen, dass die „gute alte Zeit“ gar nicht so gemütlich war, wie es heute oft dargestellt wird, und auch die reaktionäre Rolle der Wettiner in jener ereig-nisreichen Zeit scheint heute fast vergessen. Übrigens geriet auch Theodor Esche, Geschäftsführer der Firma Moritz Samuel Esche, damals in arge Bedrängnis, da man ihm vorwarf, Waffen an die Aufständischen geliefert zu haben. Ihm gelang es jedoch, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.Das Unternehmen von Joseph Sallmann war das erste dieser Branche in der Schweiz und ist heute mit zeitweise über 300 Mitarbeitern eine der bedeutendsten Trikotagenfabriken des Landes. Joseph Sallmann aus Limbach gilt also wohl mit Recht als der Begründer der Schweizer Trikotagenindustrie. Dietrich Donner Der Autor Robert Sallmann hat sein Buch „Joseph Sallmann 1823-1871 – Begründer der schweizerischen Trikotagenindustrie“ dem Esche-Museum geschenkt
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 07. Januar 2016 -
Anna Esche 1824 -1920 Erste Ehrenbürgerin der Stadt Limbach
Anna Esche 1824 -1920
Erste Ehrenbürgerin der Stadt Limbach
Dietrich Donner
Am 23.12.1824 wurde Anna Clauß in Chemnitz geboren, als Tochter von Henriette Sophie, geb. Rahlenbeck, und dem Gründer der Spinnerei in Flöha Peter Otto Clauß. Das Datum darf uns Anlass sein, sich wieder einmal in Erinnerung zu rufen, wer diese Frau war, zumal in Limbach-Oberfrohna sogar zwei Straßen ihren Namen tragen.
Am 18.10.1844 heiratete Anna Clauß den Limbacher Arzt Dr. Carl Julius Esche, der in vierter Generation von unserem Johann Esche abstammt, und der ab 1847 als Teilhaber in die Firma Moritz Samuel Esche eintrat, die er mit seinem Bruder Theodor gemeinsam führte. Das Ehepaar wohnte in der Villa am heutigen Anna-Esche-Gässchen.
Anna Esche zeichnete sich bis ins hohe Alter durch ein hohes soziales Engagement für die Armen Limbachs aus. Sie war Mitbegründerin und Vorsitzende des Albertzweigvereins Limbach, der armen Kranken Hilfe spendete. 1882 wurde in Limbach eine „Kinderbewahranstalt“ gegründet, in der die noch nicht schulpflichtigen Kinder von berufstätigen Frauen gegen geringes Entgelt ganztags betreut wurden. Frau Esche gehörte von Anfang an dem Vorstand dieser Einrichtung an und zählte zu den tatkräftigsten Förderern. Hatte sie bisher schon jährlich 600 Mark gespendet, stiftete sie im Jahr 1890 15.000 Mark von gesamt 18.000 für einen Neubau, der 1890 eingeweiht wurde. Diese Einrichtung war die erste Kindertagesstätte unserer Stadt und war mit großen Aufenthaltsräumen und Garten er¬staunlich modern. Sie bot 40 bis 60 Kindern Aufenthalt.
In der Inflation 1923 geriet diese Einrichtung in wirtschaftliche Schwierigkeiten, und die Firma Johannes Richter erwarb das Gebäude, ein rotes Backsteinhaus an der Südstraße.
Bis zur Wende wurde es genutzt. Viele Limbach-Oberfrohnaer erinnern sich noch, den Hort in diesem Gebäude besucht zu haben. Im Jahre 2004 stand es zwar noch, machte aber schon einen trostlosen Eindruck. Verblassend war auf einem Putzband sogar noch „Kinderbewahranstalt“ zu lesen. Inzwischen ist es abgerissen. Schade drum!
Anna Esche beteiligte sich noch an einer Reihe weiterer Schenkungen und Stiftungen für soziale Zwecke, z. B.: 1894 an der Geschwister-Esche-Stiftung mit 32.000 Mark. Sie wurde 1896 für ihr soziales Engagement zur ersten Ehrenbürgerin der Stadt Limbach ernannt, auch erhielt sie mehrere hohe Auszeichnungen. Sie starb im hohen Alter von 96 Jahren bis zuletzt geistig rege und hochgeehrt am 16. Februar 1920.
Ihr Wohnhaus, die Limbacher „Esche-Villa“ befindet sich noch immer im Anna-Esche-Gässchen, ist äußerlich nahezu unverändert und wird noch immer genutzt.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 17. Dezember 2015 -
Industriegeschichte im Blickwinkel einer Lesung in der Stadtbibliothek
Industriegeschichte im Blickwinkel einer Lesung in der Stadtbibliothek
Dr. Andreas Eichler
Irmgard Eberth und Klaus Dietz stellten ihre Beiträge in dem neu erschienen Band „Not macht erfinderisch. Zur Geschichte der Industrie in der Region Chemnitz-Zwickau. 1945 – 1990 – 2015“ kürzlich mehr als 30 Besuchern bei einer Lesung in der Stadtbibliothek vor. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Vorsitzenden des Heimatvereins Niederfrohna, Dr. Andreas Eichler, dem Herausgeber des Bandes. Er erinnerte zunächst daran, dass der Heimatvereins seit Anfang der 1990er Jahre regelmäßig Heimathistoriker zu Tagungen nach Niederfrohna einlädt. Seit 1995 wurden regelmäßig Dokumentationsbände dazu herausgegeben.
1945 wurden in Ostdeutschland zahlreiche Mittelständler mit der Begründung enteignet, „Nazi- und Kriegsverbrecher“ zu sein. 1946 wurde versucht, mit einem Volksentscheid dieses Vorgehen nachträglich zu legitimieren. Durch den Vorstoß der 3. US-Armee war in der Region am 14. April 1945 der Krieg beendet. Über Nacht mussten wieder Gebrauchsgegenstände produziert werden. Gerade in der Notsituation zeigte sich die mitteldeutsche Innovationsfähigkeit vielleicht am deutlichsten. Wie war das beim VEB Feinwäsche „Bruno Freitag“ und bei Hempel-Limbach-Radio (HELI Radio)? Irmard Eberth erklärte, dass die Firma Paul Stelzmann Wirkwaren AG 1945 mit der Begründung „Nazi- und Kriegsverbrecher“ enteignet wurde. Der Inhaber Paul Stelzmann wurde im Zuchthaus Bautzen inhaftiert, nach viereinhalb Jahren wegen guter Führung entlassen und in die Bundesrepublik abgeschoben. Paul Stelzmann war ein innovativer Unternehmer, der zahlreiche Patente innehatte. Bereits vor 1914 war er von der damals üblichen Handschuhproduktion zur Herstellung kunstseidener Unterwäsche übergegangen. Die Firma Stelzmann wurde als Volkseigener Betrieb (VEB) „Pastell“ weitergeführt, später in VEB Feinwäsche, dann in VEB Feinwäsche „Bruno Freitag“ umbenannt. Der Betrieb wurde mit seinen etwa 4000 Beschäftigten der größte Hersteller von Unter- und Nachtwäsche in der DDR. 1972 musste das Unternehmen eine größere Anzahl von enteigneten mittelständischen Betrieben aufnehmen. Die Zahl der Produktionsstätten stieg, auch im Zusammenhang mit Strukturveränderungen durch die „Kombinatsbildung“, auf über 1000 an. Die Wäscheproduktion für den Export erforderte modische Produkte in hoher Qualität. Ende der 1980er Jahre habe man die Gestattungsproduktion mit Schießer aufgenommen. 1990 hätten zahlreiche westdeutsche Unternehmen den VEB Feinwäsche übernehmen wollen. Den Zuschlag habe die Treuhandorganisation aber einem eher kleinen Unternehmen, dessen Inhaber auch als Immobilienhändler tätig war, gegeben. Mit diesem Unternehmen sei der VEB Feinwäsche, trotz voller Auftragsbücher und schwarzer Zahlen, in die Insolvenz gestrudelt, so Irmgard Eberth. Heute erinnern noch einige ehemalige Industriebauten an das Unternehmen.
Klaus Dietz erzählte, dass der Ingenieur Bodo Hempel am 25.7.1947 als Geschäftsführer in das „Labor für Hochfrequenztechnik« in Oberfrohna eintrat. Am 1. April 1950 habe er eine eigene Rundfunkgerätebau-Firma gegründet. In dieser Zeit existierte in Limbach ein „Wehrmachtselektronik Sichtungs- und Zerlegewerk“. Von dort stammten die Einzelteile, die Bodo Hempel und seine Kollegen in den Anfangsjahren zu traditionellen Radios umbauten. Es war im Grunde eine Konversion von der Rüstungs- zur Gebrauchsgüterproduktion. Das Unternehmen hatte in seiner größten Ausdehnung etwa 100 Mitarbeiter und entwickelte neben Radios auch Studio- und Aufnahmetechnik. Bodo Hempel habe die Firma geführt, wie ein Vater die Familie, sagte Klaus Dietz. Hohe Anforderungen an seine Mitarbeiter seien mit Fürsorge verbunden gewesen. Bodo Hempel selbst sei den Mitarbeitern auch ein Vorbild im Arbeitseinsatz gewesen. In Erinnerungen seien ihm legendäre Feiern der Belegschaft und gemeinsame Urlaubsreisen. Einmal habe Bodo Hempel einen ganzen Express-Zug für die Firma gemietet. Hempel habe ihn schon als Lehrling zu innovativen Ideen angeregt und als späteren Leiter der Entwicklungsabteilung freie Hand gelassen. So habe man Schritt für Schritt die innere Struktur von Radiogeräten verändert und den neuen Nutzererwartungen angepasst, zum Beispiel Anschlussbuchsen für Zusatzgeräte an die Vorderfront gelegt und ähnliches. Zur Leipziger Messe 1960 sprachen zwei junge Absolventen der Kunsthochschule Weißensee bei Hempel vor: Lutz Rudolph und Carl Clauss Dietel. Mit beiden ergab sich eine jahrelange fruchtbare Zusammenarbeit. Das Logo der Firma wurde neu gestaltet und die Schritt für Schritt entwickelten die beiden Designer mit den neuen Rundfunkgeräten eine eigene Formensprache und einen Programmcharakter, so dass die kleine Firma HELIRADIO zu einem Geheimtipp unter Kennern und internationalem Trendsetter wurde. 1972 wurde aber auch dieses Unternehmen enteignet und in Kombinatsstrukturen eingeordnet. Bodo Hempel wurde krank und schied aus dem Unternehmen aus. 1990 mobilisierte Bodo Hempel noch einmal seine Energie für einen Neustart. Doch dieses Mal machte ihm die Gesundheit die Hoffnung zunichte. Er verstarb völlig unerwartet. Nach seinem Tod scheiterten alle Bemühungen zum Neustart des kleinen Nischenproduzenten. Das Unternehmen ging in die Insolvenz.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 03. Dezember 2015 -
In der ersten „Post“ Limbachs
In der ersten „Post“ Limbachs
(entnommen aus Mitteilungen des Fördervereins Esche-Museum e.V., Nr. 11)
Zu den vielen „Schätzen“, die interessierte Bürger für den Sammlungsbestand im Esche-Museum abgeben, gehört auch ein Sonderdruck, den Familie Kaufmann aus Düsseldorf brachte. Der Sonderdruck enthält neben Aufsätzen von Paul Fritzsching eine kleine, namentlich nicht gekennzeichnete, Szene über die erste „Poststation" in Limbach. Sie ist hier - nur leicht gekürzt - wiedergegeben.
„Adolf! - Adolf! - Wo nur der Saujunge wieder mal steckt,“ brummte der Strumpfwirkermeister Zwingenberg. ...Endlich antwortete es aus dem Schuppen „Ja!“. „Biste schon wieder bei den Karnickeln? - Hier, schaff‘ schnell den Brief zu Börngens! Aber halt‘ch unterwegs gar nich‘' auf; ‚s geht schon uff zwee und fort muß‘r heute noch. Hier is‘ e „Viergroschenstück"! 1) Verlier‘s nich‘! Kriegst Geld wieder!"
Adolf sauste fort. Der Vater schaute ihm nach, bis der Junge ein Stück weiter unten um die Ecke bog.... Gleich am Eingange zum „Dorfe" stand an einem überengen Gässchen ein kleines, schieferbeschlagenes und schiefergedecktes Häusel. Es war kein Neuling. Man sah es ihm außen und innen an. Das gehörte dem Sattlermeister Börngen, einem klugen und geachteten Manne im Dorfe. Er war bei der Einrichtung einer Poststelle in Limbach zum „Postmeister" gewählt worden, und sein Häuschen war demnach das erste hiesige „Postamt". 2)
Als Adolf zum Häuschen kam, war es kurz vor 2 Uhr nachmittags. Meister Börngen stand unter der Haustür und lugte umher, ob noch jemand was brächte. Er füllte mit seinem kräftigen Körper die ganze Türöffnung aus. Durch die grüne, hinten mit einer blanken Messingkette zusammengehaltene Latzschürze und mit seinem Käppchen auf dem Kopfe machte er auf alle einen höchst würdigen Eindruck. Über die Brille hinweg sah er den Adolf mit dem Brief in der Hand angepustet kommen. „Bringst noch was, Kleenes? ‘s wird Zeit! Bald wird der Briefträger abrücken.“ Adolf war etwas bestürzt über den Empfang. Schweigend forte er dem Meister in die Wohnstube.
Am Tische in der Mitte der kleinen, niedrigen Stube saß auch schon der Briefträger. Der Mann in dem zitronengelben Rock mit den „goldenen“ Knöpfen und in den hohen Kanonenstiefeln machte einen so packenden Eindruck auf Adolf, dass er seine gestrickte Mütze abzunehmen vergaß. „Nu, hast wohl Stare unter deiner Mütze?“, wurde er vom Meister Börngen angeniest. Gib deinen Brief her!“ Adolf reichte ihm seinen Brief und das „Viergroschenstück“. Meister Börngen trug die Anschrift des Briefes in das Amtsbuch ein und legte ihn zu den anderen in den Tischkasten. Im Glasschranke auf der Kommode zog er ein Kästchen, warf das „Viergroschenstück“ hinein und gab Adolf vier Neugroschen zurück. Adolf gesellte sich zaghaft zu Karl, Börngens Jungen, der am Fenster saß und an einem Riemen für seinen Vater nähte. Es trieb ihn mehr die Neugierde als die Freundschaft zu Karl.
Zwei Uhr war es jetzt. Meister Börngen nahm alle Briefe aus dem Tischkasten, verglich ihre Zahl und Anschriften mit seinen Angaben im Amtsbuche und packte sie dann alle in die Ledertasche des Postboten. Der hing diese auf die Schulter, setzte die hohe, oben etwas nach vorn gezogene, gelbe Mütze auf, nahm den festen Knotenstock zur Hand und rückte unter Gruß wohlgemut ab. Meister Börngen begab sich in seine Werkstatt. Das „Postamt“ war geschlossen bis 10 Uhr vormittags des anderen Tages. Adolf eilte nach Hause, lieferte die zurückerhaltenen vier Neugroschen ab und erfuhr nun noch vom Vater, dass der Briefträger die Briefe nach dem Postamte in Chemnitz trage und heute Abend die neuen für Limbach und Umgegend mitbringe. Diese müsse er am folgenden Tage austragen.
1) Das Viergroschenstück galt 4 alte „gute" Groschen zu je 12 '/2 Pfennig, später 5 Neugroschen zu je 10 Pfennig.
2) 2) bis 1850
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 19. November 2015 -
Bleichdorf Bräunsdorf
Bleichdorf Bräunsdorf
Text und Grafik: Siegfried Frenzel
Wie wir Bräunsdorfer in diesem Jahr unser Heimatfest feiern, ist wohl in gleich mehrfacher Weise ungewöhnlich. Einmal feiern wir, wie das Programm zeigt, über das ganze Jahr hindurch verteilt und zum anderen machten wir einen historischen Umzug, der nicht wie gewöhnlich sonntags, sondern sonnabends, stattfand und außerdem aus dem Rahmen fallend mit der beginnenden Industrialisierung endete. Die Feierlichkeiten gingen dann am Sonntag weiter und die nächsten Veranstaltung „Dorfmeisterschaften Badminton“ am 19. September sowie das „Oberdorffest“ am 10. Oktober sind bereits Geschichte.
Der 725 Jahre urkundlicher Ersterwähnung gedenken wir. Die Besiedelung begann jedoch mindestens 100 Jahre früher. In der Geschichte fiel unser Dorf dadurch auf, dass es in alten Zeiten eine ganz andere Entwicklung als in den umliegenden Dörfern nahm. Man begann nämlich im großen Stil die „Rasenbleicherei“ zu betreiben. Neben der Landwirtschaft, die auch heute noch das Rückgrat der Gemeinde bildet, hat über Jahrhunderte die Bleicherei das Dorf zur Blüte gebracht. Was versteht man unter „Bleichen“? Wenn die Leinwand vom Webstuhl kommt, hat sie einen unansehnlichen grau-grünen Farbton. Deshalb bedienten sich unsere Vorfahren eben dieser so genannten „Rasenbleiche“. Man legt die Leinwandstücke auf die Wiese zur „Bleiche“, benetzt sie mit Wasser und lässt Sonne und Luft einwirken, die als Bleichmittel wirken. Diesen Vorgang betreibt man so lange, bis der gewünschte Weißgrad erreicht ist. Übrigens, unsere Großeltern machten das seinerzeit noch bei jeder großen Wäsche zu Hause.
Der Bleichbetrieb bot sich für unser Dorf an, weil die günstige Bewässerung durch den Dorfbach und unzähligen Quellen auf den weiten Talwiesen des hügeligen Umlandes dafür ideal war. Die Schönburgische Herrschaft, zu der Bräunsdorf damals gehörte, hatte nämlich unserem Dorf das Privileg zum Bleichen von Leinewand nach 1500 gegeben. Das in der Fernhandelsstadt Chemnitz schon viel früher bestehende Bleichprivileg der sächsischen Fürsten galt wegen der großen Entfernung für unser Dorf nicht. Es besagte, dass das Bleichen im Umkreis von 10 Meilen (etwa 15 Kilometer) verboten ist.
Bei der Herausbildung von Berufen in dieser Zeit wurden also die Bauern bei uns nebenberuflich zu „Leinwandbleichern“. Wiesen wurden vermehrt zum Bleichen genutzt. Das Gewerbe ging gut. Aber dann kamen die großen Kriege – der Dreißigjährige (1618-1648) und der Siebenjährige (1756-1763). Das brachte gewaltige Rückschläge. Ein wirtschaftlicher Aufschwung danach führte die Bleicherei zur Hochkonjunktur, denn will man den Aufzeichnungen des Pfarrers Brückner in der alten Kirchengalerie Glauben schenken, dann muss die Größe des Bleichbetriebes im Ort gigantisch gewesen sein.
Aus den umliegenden Dörfern brachten die Leute das Bleichgut nach Bräunsdorf. Brückner schreibt, dass „während des Sommers fast alle Plätze längs des Dorfbaches mit Leinwand belegt seien und es wurden wohl über 2000 Schock derselben hier gebleicht“. Nach einer Hochrechnung wären das auf zwei Kilometer links und rechts des Baches je 25 Meter Leinwandstücke! Das war wohl doch etwas übertrieben?
Dennoch war der Bleichbetrieb so groß geworden, das viele Bauern den Anbau von Getreide auf Flachs umstellten und viele wurden sogar zu „Leinwandhändlern“. Um noch mehr Flächen zum Bleichen nutzen zu können, legten unsere Vorfahren künstliche Bewässerungsgräben an, die teilweise heute noch im Dorf zu sehen sind. So entstanden vor allem im Oberdorf große Bleichen, wie die von Bretschneiders und Börnigs.
Unsere Vorfahren bleichten aber nicht nur, sondern sie betrieben ja die gesamte „Flachsaufbereitung“ bis zur versponnenen Faser und darüber hinaus wuschen, stärkten, glätteten, rauten, färbten, sanforisierten, maßen und legten sie die Leinwand. Sie machten praktisch die gesamte „Textilveredelung“ (Appretur, auch Ausrüstung genannt).
Die Aufbereitung des Flachses zur Faser und die Veredelung des Rohleinens, waren die Besonderheit, die Bräunsdorf in der Entwicklung der Gewerbe seit dem Dreißigjährigen Krieg von den umliegenden Ortschaften unterschied und ihm letztlich den Beinamen „Bleichdorf“ gab. Denn gesponnen und gewebt wurde in allen umliegenden Orten, kaum aber aufbereitet und veredelt. Man könnte fast behaupten, dass in Bräunsdorf die Wiege der Veredelung textiler Rohstoffe stand!
Erst als sich im 19. Jahrhundert immer mehr die Baumwolle als neuer Rohstoff dem Leinen gegenüber durchsetzte, ging das Bleichen im Ort mehr und mehr zurück. Insgesamt konnten durch meine Nachforschungen 14 Bleichen dokumentiert werden. Das war eine große Zeit im Wirken unserer Vorfahren. Damit waren sie Wegbereiter für die späteren Färbereien in Limbach-Oberfrohna. Wir können stolz auf sie sein!
Wer mehr über die Bleicherei und überhaupt über unser Dorf wissen will, dem empfehle ich mein Buch: „Bräunsdorfer Geschichten und Geschichte“.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 22. Oktober 2015 -
Oberfrohna
Oberfrohna
Dr. Hermann Schnurrbusch
Seine Hefte zur Heimatgeschichte vertreibt die Buchhandlung am Johannisplatz 3
Oberfrohna hat eine lange Geschichte - einst blühende Stadt, jetzt verfallender Orts-teil von Limbach-Oberfrohna.
Im 12. Jahrhundert gegründet, kommt ein Ritter de frone als Zeuge auf einer Urkunde schon 1236 vor. Der Name des Ortes wird im Lauf der Geschichte verschieden geschrie-ben, wie vrone, fronaw, cuerchfrone, twerichfrone, Oberfrohne. Das Waldhufendorf, dem man seine Herkunft heute noch im Flurplan ansieht, bleibt in Einwohnerzahl und Struktur lange Jahrhunderte unbedeutend wie seine "Geschwister" Mittel- und Nie-derfrohna. 1941 bezeichnet die Chemnitzer Tageszeitung den Ort als die „blühendste der Frohnen“. Die Einwohner leben von der Landwirtschaft, als Nebenerwerb wird die Tuchweberei betrieben. Drei Mühlen werden erwähnt. 1585 erwirbt die im Rittergut Limbach sitzende Familie Schönberg Oberfrohna. Auf der Gesamtfläche des Dorfes von ca. 400 Hektar gibt es ziemlich konstant über die Jahrhunderte etwa 18 Gehöfte, 15 Häuschen mit Garten und 50 weitere Häuschen und nicht mehr als 150 - 200 Einwohner. Einzelne Namen des 16. Jahrhunderts sind heute noch nachweisbar: Semmler, Lindner, Geißler, Landgraf, Pfau, Kühn oder Esche. 1885 zählt man schon über 600 Haushaltungen, 234 Häuser und 2.398 Einwohner. Im 18. Jahrhundert hatte durch den Nachbau eines Handwirkstuhles durch Johann Esche die Strumpfwirkerei Einzug gehalten. Der große Sprung in der Entwicklung zum Industriedorf geschieht aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Handschuhfertigung. In wenigen Jahrzehnten ändert sich das Bild des Dorfes. 1889 gibt es in Oberfrohna 35 Handschuhfabriken und Großhandlungen, 6 Appreturen und 4 Färbereien. Die Einwoh-nerzahl steigt 1900 auf 3.876 Seelen.
Mit wachsendem Selbstbewusstsein macht sich das Dorf immer mehr unabhängig von der Obrigkeit in Limbach: 1827 wird die erste eigene Ortsschule eingeweiht, 1886 die neue Schule an der Hauptstraße. 1900 gibt es schon Post, Gaswerk und Apotheke, den eigenen Friedhof. 1893 ist die neue Kirche entstanden, die 1934 ihren heutigen Namen "Lutherkirche" erhält. Oberfrohna war 1890 aus Limbach "ausgepfarrt", eigene Kirchgemeinde geworden. 1891 werden in Oberfrohna 188 Kinder geboren, 1994 sind es in Limbach-Oberfrohna noch 111. Bis etwa 1910 erlebt die Handschuhindustrie ihre größte Blüte, dann wird ein Strukturwandel hin zur Kunstseidenverarbeitung vom Handschuh zur Damenunterwäsche erfolgreich gemeistert. Bis 1914 werden Pfarrhaus, Wasser-, Elektrizitätswerk und Postamt gebaut. Ein Schwimmbad an der Neuen Straße entsteht 1904, Bahnhof und Eisenbahnanschluss 1913.
Im ersten Weltkrieg sind in Oberfrohna 216 Gefallene zu beklagen. Die Zeit nach 1918 bringt Inflation und Hunger, Arbeitslosigkeit und Not, die 1933 mit 1.300 Erwerbslosen bei 6.500 Einwohnern gipfelt. Das Jahnhaus wird 1929 nach nur 10 Monaten Bauzeit einge-weiht. 1933 beginnt für die Oberfrohnaer über ein halbes Jahrhundert Diktatur, erst die des "Dritten Reiches" über 12 Jahre, dann die des real existierenden Sozialismus bis 1989. 1935 hat Oberfrohna 6.700 Einwohner und baut an der Hainstraße Sparkasse und Girobank. Einen vom Lehrer Kühnert gegründeten "Sparkassenverein" gab es bereits 1870. Das politische Milieu am Ort ist mehr durch bürgerlich-konservative Einflüsse ge-prägt als durch kommunistisch-revolutionäre wie im „roten Limbach“. Den Höhepunkt sei-ner Entwicklung hat Oberfrohna 1935 erreicht, als dem Ort der Status als Stadt verliehen wird. Die dafür notwendige Einwohnerzahl von über 10.000 war durch Eingemeindung des Nachbar-ortes Rußdorf 1935 zustande gekommen.
Der II. Weltkrieg bringt den Oberfrohnaern nach anfänglicher Siegeszuversicht Not, Hun-ger und Angst in den Bombennächten. An ein schreckliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit erinnert das Denkmal im Gemeindewald für den Polen Leon Tobola, der wegen „Rassenschande“ gehenkt wurde. Im Krieg sind 317 Oberfrohnaer gefallen, allein der Bombenangriff am 6.Februar 1945 fordert 14 Tote, 30 Häuser werden zerstört. Am 14. April wird die Stadt durch die US Army besetzt, am 13. Juni 1945 durch die Rote Armee. Damit beginnen bis 1990 die Jahre der roten Diktatur, legitimiert nicht durch freie Wahlen, sondern durch die Panzer der sowjetischen Besatzungsmacht.
Nach 1945 sind die Jahre des schweren Anfangs gekennzeichnet von Aufbau- und Überlebenswillen. Die in „Volkseigentum“ überführten, alten Firmen produzieren unter den Bedingungen des RGW für Inland und Ostexport und geben den Oberfrohnaern Lohn und Brot. Unter dem 1946 eingesetzten SED-Bürgermeister wird Oberfrohna 1950 von Limbach eingemeindet. Das war schon mehrfach versucht worden, aber immer an den Oberfrohnaern gescheitert. Seitdem sitzt die Obrigkeit wieder in Limbach. Der gemeinsame Ortsname ist „Limbach-Oberfrohna“, aber Faulheit und Denkschwäche spricht oder schreibt oft von den „Limbachern“, wenn die Einwohner der ganzen Stadt gemeint sind.
Die „Verwaltung des Mangels“ in der DDR bewirkt den Niedergang des Ortsteils Ober-frohna. Läden schließen, Gebäude verfallen, Menschen fliehen westwärts. Wenn Neu-baugebiete entstehen, dann in Limbach an der Straße der Genossenschaft, Am Hohen Hain oder Wasserturm. Für Oberfrohna reicht die „Baukapazität“ für den „Pappelhain“, aber nicht, um den Verfall aufzuhalten.
1990 kommt mit der deutschen Wiedervereinigung erneut Hoffnung auf. Vielleicht kann der verfallende Stadtteil wiederbelebt werden? Aber auch diesmal reicht es nicht für Oberfrohna. Böse Zungen haben behauptet, der „Aufschwung Ost“ finde im Westen statt. Ebenso könnte man meinen, die Entwicklung der Stadt Limbach-Oberfrohna finde in Limbach statt. Wohnungsbau auf der Süd-, Teichstraße oder Marktsteig, Geschäfthäuser an Jäger- und Weststraße oder dem Johannisplatz, die Innenstadtsanierung oder Vorhaben wie Sporthalle, „Spaßbad“ oder „Amerika-Zoo“ gibt es in Limbach, nichts Vergleichbares im Ortsteil Oberfrohna. 1996 wird mit dem Anschluss an die Kanalisation der Limbacher Zustand von 1927 erreicht. Wer einmal die Frohnbachstraße (Hauptstraße) entlang geht, wird traurig beim Anblick leerstehender Ruinen. Was ist geworden aus der ehemaligen Rosenapotheke, den Restaurants „Zur Post“ und „Rautenkranz“ oder gar den Weltfirmen Herrmann Dittrich oder Hermann Grobe AG? Jetzt müssen die Bürger froh sein, wenn sie ihren täglichen Bedarf an Lebensmitteln einkaufen können. Nur an Einkaufsmöglichkeiten für Möbel ist kein Mangel. Sinnigerweise befindet sich das „Limbacher Möbelhaus“ auf der Wolkenburger Straße in Oberfrohna.
Die Oberfrohnaer werden ihr über 100 Jahre altes Bemühen um Gleichberechtigung fort-setzen müssen, wenn Oberfrohna nicht zweitrangiger, verfallender Ortsteil bleiben will. Es ist unerheblich, ob in Limbach der Feudalherr oder die Politik-Lobby sitzt. Auch unter demokratischen Verhältnissen hat nur der eine Chance, der sich durchsetzt. Hoffen wir, dass sich die Bürger dieses Stadtteiles an ihre Geschichte erinnern und an die Tatsache, dass jeder nur das erreicht, was er selbst erkämpft. Allerdings müssten die Bewohner von Oberfrohna sich ihrem Ortsteil zugehörig und verantwortlich fühlen und wieder zu einer Gemeinschaft finden, wie sie in Bräunsdorf, Pleißa, Rußdorf u.a. noch vorhanden ist.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 08. Oktober 2015 -
Hermann Reichenbach - Maschinenfabrikant
Hermann Reichenbach - Maschinenfabrikant
aufgeschrieben von dem Sohn Ernst Reichenbach, 28.04.1925
Material aus dem Sammlungsbestand des Esche-Museums
Ein großer Förderer unserer heimischen Handschuh- und Wirkindustrie war der Maschinenfabrikant Hermann Reichenbach, geb. am 07.04.1814, gest. 10.07.1881.
Als alter Strumpfwirkermeister und aus kleinsten Anfängen baute er um 1840 die Handkettenstühle. Viele von diesen Erzeugnissen wurden nach Apolda abgesetzt, wo Reichenbach eine gefeierte Person war bei der Ablieferung seiner Maschinen. Im Jahre 1854 wurde außer Kettenstühlen der Bau von Nähma¬schinen aufgenommen, und zwar die sogenannten, von Reichenbach konstruierten Kranznähmaschinen, Rändernähmaschinen sowie Flachkettelnähmaschinen. Diese Maschinen fanden hauptsächlich Verwendung für geschnittene Waren (Schlauchstrümpfe). Ihr Bau wurde in dem Schnabel Gottfried'schen Haus, Dorotheenstraße 34 ausgeführt. Im Jahre 1856 wurde die Fabrikation im eigenen neuerbauten Hausgrundstück weiter betrieben, zwischen dem damaligen Gemeindeweg (jetzt Frohnaer Straße) und der Gasse (heutige Helenenstraße) an einem dazwischen liegenden Feldweg (Wiesenweg 1785!) als erstes Hausgrundstück der heutigen Albertstraße Nr. 14. Hier wurde mit Hochdruck gearbeitet, so dass der Handschwungradbetrieb bald aufhörte und an dessen Stelle der Betrieb durch Dampfmaschinen erweitert wurde. Im Jahr 1860 baute Reichenbach eine Nähmaschine zum Zusammennähen von Handschuhen. Diese Maschine kostete 66 Thaler, und es wurden viele Tausende auch im Umkreis von Limbach verkauft. Auch übergab Reichenbach die Genehmigung für den Bau dieser Maschinen gegen eine geringe Patentsteuer den Maschinenbauern Oscar Rudolf und der Fam. Müller und Neu¬mann, beide Firmen in Limbach. Die Fabrikationsräume reichten nicht mehr aus, und so wurden drei Werkstätten errichtet, eine davon in der früheren Schule auf der Gasse (Helenenstraße 44) und die andere beim Maurer Kühnen, heutige Albertstraße Nr. 18. Im Jahre 1868 wurde der Fabrikbau erweitert, die erwähnten beiden Werkstätten eingezogen und die Fabrikation durch eine größere Dampfanlage mit Dampfschornstein ergänzt, so dass nunmehr pro Woche 35 bis 40 Maschinen die Fabrik verließen. Außer vielen Patenturkunden erhielt Reichenbach ein weiteres Patent über eigens konstruierte Rundkettelmaschine und zwar mit vertikal stehenden Aufstoßnadeln. Die dazu gehörige Kettelnähnadel hatte Reichenbach damals schon mit der Ausfräsung über dem Öhr, wie dieselbe heute für die Schnellnähmaschinen Verwendung findet, ausgerüstet. Dies war gleichfalls Reichenbachs Erfindung. Diese Maschine wurde für die feinsten und stärksten Waren geliefert.
Zu Beginn der 70er Jahre erhielt Reichenbach ein Patent über Dampfhähne mit Schraubenventil, welche das Tropfen der Kegelhähne beseitigten. Weitere Patente waren die Zylinderschlauch-Nähmaschine, sogenannte Rechtsnaht für starke Tuchhandschuhe und eine Zylindernähmaschine mit meliertem Stich.
Weit über Deutschlands Grenzen hinaus wurden die Erzeugnisse der Fa. Hermann Reichenbach verbreitet und waren die Absatzgebiete auch im Ausland Italien, Russland, Amerika, Frankreich, Schweden und Norwegen.
Kurz vor seinem Tod hatte Reichenbach auch den Bau von mechanischen Kettenstühlen mit aufgenommen, wovon mehrere dieser Stühle in Betrieb kamen. Nach dem Ableben übernahmen die beiden Söhne Ernst und Victor den Betrieb und erweiterten denselben noch durch den Bau von Cops-Spulmaschinen von 4 bis 60 Spindeln bis zum Jahr 1887, wo 40 bis 50 Arbeiter ihre Beschäftigung fanden. Von da ab war der Teilhaber Victor Reichenbach al-leiniger Inhaber.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 24. September 2015 -
Bräunsdorf: Das Museumsdorf und die Gestaltungssatzung
Bräunsdorf: Das Museumsdorf und die Gestaltungssatzung
Hartmut Reinsberg
Ja, so nannten Anfang der 1990er Jahre einige Mitbürger unseren Ort, welcher sich bemühte in das sächsische Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen zu werden. Wie in so vielen Orten, dachte sich so mancher Landbesitzer, nun nach dem die Wende überstanden war und man plötzlich wieder über seine eigene Scholle bestimmen konnte, kann man darüber verfügen wie man so will. Und viele dachten da halt sehr praktisch und wollten die eine oder andere Fläche zu einem guten Preis als Bauland verkaufen. Da es mit der Wende auch eine neue Gesetzeslage gab und die Gemeinde über die Planungshoheit verfügte und mit einem Flächennutzungsplan festlegen konnte, wo sich der Innenbereich des Ortes befindet und wo eine Baulücke ist, damit konnte sich so mancher Neubürger der Bundesrepublik nicht gerade anfreunden. Man hatte gerade sein Eigentum wieder in Besitz genommen und dachte, nun kann man loslegen. Dass Eigentum verpflichtet und im neuen System mittels Gesetzeskraft auch neue Spielregeln bestanden, dass wollte so mancher nicht so recht verstehen.
Man konnte gar nicht so schnell zuschauen, wie plötzlich eine Menge Interessenten aufkreuzten, welche in dem landschaftlich reizvollen Außenbereichsflächen ihre Traumranch errichten wollten. Aber auch phantastische Eigenheimsiedlungen auf bestem Ackerland am Waldrand in ruhiger Lage waren gefragt. Dabei muss man einmal bedenken, dass Generationen von Bauern ihre schönen Gehöfte entlang des Dorfbaches und der Straße mit geräumigen Freiflächen errichteten auf denen sich alte Streuobstwiesen, Gartenflächen für Kräuter und Gemüse, Weiden fürs Groß- und Kleinvieh und natürlich auch Teichanlagen für die eigene Fischversorgung befanden.
Diese Siedlungsstruktur war insbesondere im Niederdorf seit dem mühevollen Wiederaufbau nach dem vernichtenden 30-jährigen Krieg entstanden. Erst die mahnende Hinweise der Denkmalbehörden und die Unterschutzstellung von über 50 historischen Gebäuden in den historischen Ortsteilen und die dann folgende Festlegung eines sächsischen Flächendenkmals in eben diesen Ortsbereichen brachte eine gewisse Ernüchterung. Für so manchen Mitbürger war dies eine kalte Dusche, der Traum vom Verkauf von Bauland war ausgeträumt. Sicher war dabei nicht nur das rasche Geldverdienen im Vordergrund, denn so mancher Besitzer von ehrwürdigen Gehöften und Häusern hätte den Verkaufserlös auch für eine anstehende dringende Sanierung seiner Gebäude eingesetzt.
In dieser Zeit wurde mir nahe gelegt, am Eingang des Flächendenkmalbereichs einen Schlagbaum anzubringen und ein Denkmalsdorf zu betreiben, denn zu was Anderen tauge ja der Rest des Ortes nicht. Heiße Debatten im Gemeinderat und auf Einwohnerversammlungen folgten, wo einige Bürger wutentbrannt vorzeitig den Raum verließen und beim Türenknallen der Putz von der Wand rieselte. Als der Gemeinderat begann, für den historischen Ortsteil eine Gestaltungssatzung zu erstellen, um damit dieses Gebiet durch ein örtliches Baurecht zu erhalten, errötete so mancher Kopf.
Heute nachdem es uns mit unserer Gestaltungssatzung gelungen ist, die einmalige Dorflandschaft zu erhalten, sagt so mancher Widersacher aus der Nachwendezeit: „Ein Glück, dass wir unseren Ort so in seiner Ursprünglichkeit erhalten haben.“ Wer zu uns kommt, erlebt noch ein schönes sächsisches Dorf im sächsischen Burgenland im Nebental der Zwickauer Mulde im reizvollen Mittleren Muldental zwischen Waldenburg und Wechselburg.
In der Zwischenzeit haben wir mit der typisch ländlichen Prägung eines Reihendorfes, entlang des Dorfbaches in einem idyllischen Tal, neben den drei Pensionen in früheren Wassermühlen, einiges für den sanften Landtourismus getan.
Natürlich kommen die Besucher nicht in Scharen, aber es kommen Leute, welche den ländlichen Raum mit seinen unverfälschten Reizen suchen. Dort wo es noch Hühner auf den Hof gibt, wo Kühe, Schafe und Ziegen auf der Weide zu beschauen sind und der dörfliche Tagesablauf durch das bäuerliche Leben geprägt ist. Es herrscht da nicht immer die gewünschte Ruhe, denn die Tiere auf der Weide kann man hören und die Landtechnik bei der Feldbestellung und Ernte ist zu Spitzenzeiten auch rund um die Uhr zu hören. Aber dazwischen gibt es noch die sprichwörtliche Gelassenheit und Stille.
In Bräunsdorf, welches ab 1994 in das sächsische Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen wurde, konnten insgesamt über 150 Maßnahmen, davon über 130 im privaten und ca. 20 im kommunalen Bereich realisiert werden. Wer sich im Ort umschaut kann die zahlreichen sanierten Häuser und Gehöfte mit neu gestalteten Fassaden, frisch gedeckten Dächern und schönen Vorgärten bewundern. Im kommunalen Bereich konnten wir das Ortsstraßennetz und die Ortsverbindungsstraßen grundhaft ausbauen bzw. mit Tragschichten versehen, wobei die Fußwege, Straßenbeleuchtungen, Stützmauern und Brücken mit entstanden.
1998 haben wir uns nach einigem Hin und Her für die freiwillige Eingemeindung in unsere Nachbarstadt Limbach-Oberfrohna entschieden. Dabei konnten wir eben auch freiwillig mit der Stadt einen tragfähigen Eingemeindungsvertrag aushandeln, in dem natürlich auch die finanzielle Absicherung der Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungsplan enthalten war.
So wurden ebenfalls die Gestaltungssatzung und die Satzung über die Festsetzung von geschützten Landschaftsbestandteilen für unser Dorf übernommen. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass der Arbeitskreis für Dorferneuerung, welcher mit der Aufnahme des Ortes in das sächsische Dorfentwicklungsprogramm entstand nach der freiwilligen Eingemeindung weiter als „Verein für Dorferneuerung und Heimatpflege“ bestehen blieb, welcher sich jetzt weiter für die Erhaltung des ländlichen Raumes in unseren Ort einsetzt.
- veröffentlich im Stadtspiegel am 10. September 2015 -
Wie alt ist Limbach-Oberfrohna?
Wie alt ist Limbach-Oberfrohna?
Aus Dr. H. Schnurrbusch: Daten aus der Limbacher Geschichte bis 1945,
Limbach-Oberfrohna 2003.
Seine Hefte zur Heimatgeschichte vertreibt die Buchhandlung am Johannisplatz 3.
Die Stadt mit dem Doppelnamen gibt es seit 1950, damals wurden die Städte Oberfrohna und Limbach zusammengelegt. Oberfrohna war 1935 durch Eingemeindung von Rußdorf zur Stadt geworden. Bevor Limbach 1883 zur Stadt wurde, gab es unabhängig voneinander die Dörfer Rußdorf, Oberfrohna und Limbach, Pleißa, Kändler, Bräunsdorf. Wie alt sind nun aber diese? Erstmals erwähnt sind Bräunsdorf 1346, Kändler 1375, Kaufungen 1226, Pleißa 1375, Rußdorf 1335.
Viele Orte leiten ihr Alter aus der Ersterwähnung ab. Die erste urkundliche Nennung eines Ortes hat aber mit dem tatsächlichen Alter nicht viel zu tun, es sei denn, es handelte sich um Gründungsurkunden, wie es bei Bergbaustädten oft der Fall ist, z.B. Freiberg 1180 oder Annaberg 1496. Meist werden in den Urkunden Orte genannt, die schon lange bestanden haben, mitunter sogar auf ältere slawische Siedlungen zurückgehen. Will man sich aber auf historisch bewiesene Zeitpunkte verlassen, ist die Ersterwähnung des Ortes das einzig korrekte Kriterium, wenn auch Erwähnung und Gründung nicht übereinstimmen. Die ältesten Urkunden von Orten in unserer Gegend stammen aus dem 13. Jahrhundert und betreffen zum Beispiel Adorf und Klaffenbach 1200, Kaufungen 1226, Auerswalde 1248, Grüna 1263, Claußnitz 1277, Taura 1280 und 1299 Einsiedel.
Vor der Ersterwähnung von Orten finden sich mitunter in den Urkunden namensgleiche Personen. Ein Ritter Albert von Kallenberg taucht 1244 auf, Heinrich von Glauchau 1240. Der Bau des Waldenburger Schlosses 1165 wird von den Herren Brand und Wartha geleitet. Als Zeuge wird ein Ritter "von Limpach" 1248 und einer "von Frone" 1236 in Urkunden erwähnt. Mitunter wird der Nachweis solcher Personen mit der Ersterwähnung von Orten gleich gesetzt, das ist aber ein zumindest zweifelhaftes Verfahren. Seydel schließt aus der Erwäh-nung der Herren Brand und Wartha, dass gleichnamige Orte um diese Zeit vorhanden gewesen sein müssten, nach denen sich die Adligen benannten. Einen Beweis dafür gibt es nicht, ebenso wenig wie für die Annahme, die beiden hohen Beamten - Landrichter und Marschall - seien samt Namen zuerst in den Osten gekommen und hätten den erst später entstandenen Siedlungen ihre Benennung eingepflanzt. Der Name kann älter als die hiesige Siedlung sein. Bei Adligen sind Benennungen nach dem Familiensitz schon im 11. Jahrhundert nachweisbar. Die urkundliche Erwähnung des Namens Drachenfels 1137 im Rheinland beweist nicht die Ersterwähnung der Burg Drachenfels bei Penig, die Erwähnung des Ritters "de frone" nicht die Ersterwähnung von Niederfrohna, die des Johannes de Limpach 1248 erbringt nicht den Nachweis dieses Ortes. Solche Namen sind wertvolle Hinweise, wenn sie kritisch im gesamten historischen Kontext gesehen werden, die Ersterwähnung eines Ortes ist ein Personenname nicht. Eine alte Urkunde erwähnt „Vrono et Lympach“ 1366 (HStA 10004 Kopiale, Nr. 27, Bl. 73b). „Twerchfrone“ wird 1412 genannt (HStA, 10004 Kopiale, Nr. 1303, Bl. 90a) , die „vrone“ (der Bach) schon 1285.
Schwierig ist es auch, aus den Ortsnamen, Dorf- und Flurformen Rückschlüsse auf das Alter zu ziehen. Namen sind manchmal mit den Siedlern gewandert, auch alte slawische Orts-, Flur- oder Gewässer-bezeichnungen einfach von deutscher Zunge übernommen worden (Chemnitz, Glauchau). Es gab möglicher-weise in den Anfängen der Besiedlung lockere Anhäufungen von Häusern, die keinen Namen hatten oder mehrere Siedlungen in einem Tal mit einem Sammelnamen, wie vielleicht das "Frohne", aus dem die späteren Namen Ober-, Mittel- und Nieder-Frohnen entstanden sein könnten.
Der Versuch, die Gründungszeit unserer Heimatdörfer zu bestimmen, ist so auf Vermutungen angewiesen. Vor 1100 fehlen aus unserer Gegend urkundliche Nachrichten und Belege fast völlig. Nach 1100 wird die Quellenlage ergiebiger. Urkunden bestätigen 1143 die Begabung des 1136 von Pegau aus gegründeten Benediktinerklosters Chemnitz, 1143 die Grenzfestlegung des Nonnenklosters Remse, 1166 den Tausch des Remser Stiftsgutes Weidensdorf, 1165 bis 1172 den Bau des Schlosses Waldenburg, 1168 (?) die Gründung des Klosters Zschillen, heute Wechselburg. Daraus ergibt sich nun die Annahme der Gründungszeit unserer Dörfer. Es ist wohl vertretbar, das Entstehen von Frohne, Limbach, Rußdorf und anderer Nachbardörfer in der Zeit von etwa 1150 bis 1175 zu vermuten, nunmehr also vor etwa 850 Jahren. Präzise beantworten lässt sich die eingangs gestellte Frage nach dem genauen Alter der einzelnen Teile der heutigen Stadt Limbach-Oberfrohna nach der heute bekannten Quellenlage aber nicht.
- veröffentlicht im Stadtspiegel am 24. August 2015 -